(Kirche zum Mitreden, 22.09.2002)
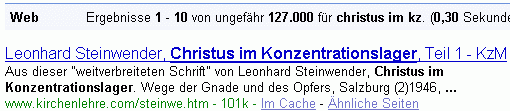
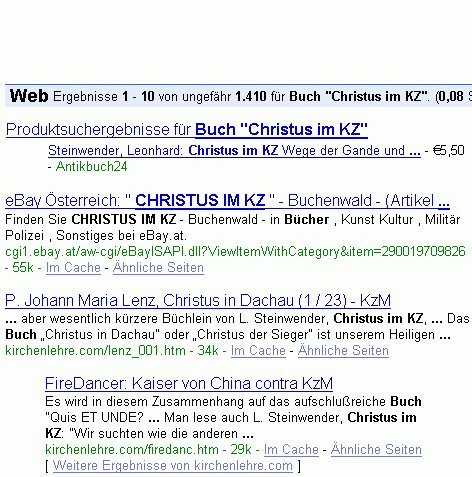
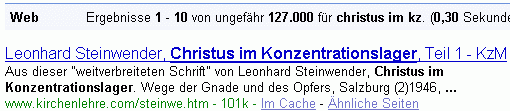
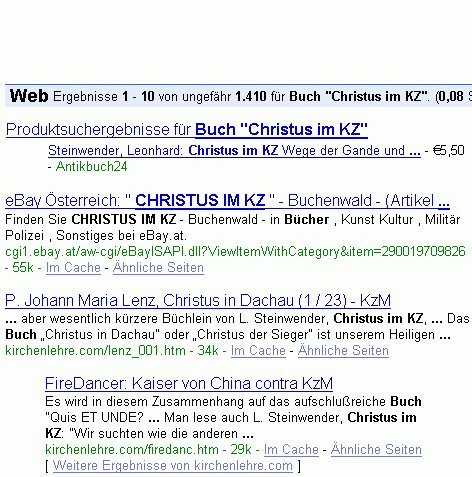
"Eine Heldengestalt der protestantischen Prediger in Buchenwald
war
Pastor Schneider. 'Sie sind ein Massenmörder!' ruft er dem
Lagerkommandanten
ins Gesicht. - 'Ich klage Sie an vor dem Richterstuhl Gottes!' -
'Christus
sagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben!' So rief Pastor Schneider
ein andres Mal aus dem Bunkerfenster zum Zählappell. Weiter kam er
nicht. Schon prasselten Schläge auf ihn herab. 'Keine heile Stelle
war an seinem Körper, als man ihn (im Sommer 1939) tot aus dem
Bunker
trug.' So berichtet Kanonikus Steinwender in seiner weitverbreiteten
Schrift
über das KL Buchenwald 'Christus im KZ'"
(J.M. Lenz, Christus in Dachau oder Christus der Sieger, Wien (6)1957,
126).
Aus dieser "weitverbreiteten Schrift" von Leonhard Steinwender,
Christus
im Konzentrationslager. Wege der Gnade und des Opfers, Salzburg
(2)1946,
zitieren wir hier ca. die erste Hälfte (7-69 von 134). Die
Wiedergabe
endet mit den beiden Kapiteln über Pastor Schneider, wobei wir
hier
an das Dogma erinnern:
"[Die heilige römische Kirche ...] glaubt fest, bekennt und
verkündet,
daß 'niemand außerhalb der katholischen Kirche, weder Heide
noch Jude noch Ungläubiger oder ein von der Einheit Getrennter -
des
ewigen Lebens teilhaftig wird, vielmehr dem ewigen Feuer verfällt,
das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist, wenn er sich nicht vor
dem
Tod ihr [der Kirche] anschließt. So viel bedeutet die Einheit des
Leibes der Kirche, daß die kirchlichen Sakramente nur denen zum
Heile
gereichen, die in ihr bleiben, und daß nur ihnen Fasten, Almosen,
andere fromme Werke und der Kriegsdienst des Christenlebens den ewigen
Lohn erwirbt. Mag einer noch so viele Almosen geben, ja selbst sein
Blut
für den Namen Christi vergießen, so kann er doch nicht
gerettet
werden, wenn er nicht im Schoß und in der Einheit der
katholischen
Kirche bleibt" (DS 1351, zit. nach NR 1938, 350).
Pastor Schneider kann gerettet worden sein, weil er im
unüberwindlichen
Irrtum über die wahre Kirche gelebt hat. Wenn von katholischer
Seite
(Steinwender und Lenz) solche Zuversicht bzgl. der Rettung Schneiders
ausgesprochen
wurde, so darf man das nicht im Sinne der V2-Häresie sehen, dass
andere
Glaubensgemeinschaften als die katholische Kirche "Wege des Heiles"
seien,
sondern nur in der Weise, wie es auch Steinwender und Lenz gemeint
haben,
nämlich im Sinne des katholischen Dogmas.
Von dem Juden Walter Süß anzunehmen, dass er gerettet wurde,
obwohl er das Taufsakrament nicht mehr in der abgesprochenen Art und
Weise
empfangen konnte, entspricht den katholischen Grundsätzen
hinsichtlich
Begierde- und Bluttaufe.
Doch geht es hier nicht eigentlich um den Protestantismus, sondern
darum,
endlich der Wahrheit über den Hitler-Terror zum Siege zu
verhelfen.
Weswegen wir so großzügig, wenngleich auch noch nicht
vollständig
das Buch von Steinwender zitieren, ist in den Ausführungen z.Th. Copyright
dargelegt.
Es muss endlich Schluss sein mit dem "Tagebuch
der Anne Frank", das bereits wegen der obszönen Passagen
verboten
IST (kirchliches Bücherverbot, wenn auch momentan nicht staatlich
durchgesetzt). Dass die Anne-Frank-Propagandistin Iris Berben
kürzlich
vom Zentralrat der Juden in Deutschland mit dem Leo-Baeck-Preis
(benannt
nach dem 1956 gestorbenen Rabbiner Leo Baeck; 10 000 Euro; früher
z.B. an Johannes Rau vergeben) wegen ihres
"mutigen
Einsatz gegen Antisemtismus und Fremdenhass und für Toleranz"
ausgezeichnet wurde, dokumentiert nur einmal mehr die
fürchterliche
Verrohung unserer Gesellschaft.
Es muss endlich Schluss sein mit den verunglimpfenden Lügen z.Th.
Kirche und Nationalsozialismus, die besonders von jüdischer Seite
ungestraft verbreitet werden. Der Staat muss endlich seine Pflicht
wahrnehmen,
die jüdische antichristliche Propaganda abzustellen.
Lügenpropaganda
wie Hochhuths "Stellvertreter" muss wirksam aus dem Verkehr gezogen
werden.
Die lachenden Dritten sind die Revisionisten, die den totalen Wirrwarr um den so gen. "Holocaust" raffiniert ausnutzen. Ein weiteres Beispiel dafür ist Ahmed Rami, der in seinem Text "Ein moderner Hexenprozess" einleitend schreibt:
Wenn Rami von Dialog spricht, so meint er damit, dass er anderen seine absurden Phantastereien aufzwingen will; in "Die Macht der Zionisten" liest sich das so:
Hier wird mal eben die Glaubenslehre über die Wahrheit der
Offenbarung
des Alten Bundes weggewischt - der Alte Bund wird zum "Mythos"
degradiert,
wobei allerdings zu fragen wäre, was das Christentum
überhaupt
noch wert sein soll, wenn die zahlreichen Beweise im NT dafür,
dass
Jesus der im AT verheißene Messias ist, nur auf einem Mythos
beruhen.
Und was den Vorzug der Juden gegenüber den Heiden betrifft: "Wir
alle
sind durch die Taufe in einem Geist zu einem Leib geworden: ob Juden
oder
Heiden, Sklaven oder Freie" (1 Kor 12,13; s. auch den "Holcaust"-Mythus-Text).
Interessanterweise wird auch von der V2-Sekte der Bezug zwischen
Judentum
und Christentum geleugnet; man lese z.B. den Abschnitt "Gott des Alten
Bundes, Gott des Neuen Bundes" in "Heil Hitler?".
Während die V2-Sekte diesen Bezug des Christentums zum Judentum
leugnet,
spricht sie im selben Atemzug von "konvergierenden
Linien" zwischen Judentum und V2-Sekte und erhebt das Verbot des
Judenhasses
zum Dogma. Christus sah sich angeblich nur "voll
und ganz als Juden", seine "Auferstehung" war angeblich "kein
historisches Ereignis" (hat also nicht wirklich stattgefunden),
womit
das Christentum sich sowieso erledigt hat, und dann ist es auch kein
weiter
Schritt mehr zu der V2-Erklärung, dass die Muslime, die
bekanntlich
die Dreifaltigkeit Gottes aufs heftigste bestreiten, denselben
Gott anbeten wie die V2-Sektierer. Man kann leicht erkennen,
welcher
"Gott" da gemeint ist...
Wer sich lieber an dem Zwangsarbeiter-Schwindel,
an den jüdischen Verunglimpfungen gegen
die
Kirche und sonstigen Ammenmärchen ergötzt, wird an dem
Steinwender-Text
wenig Gefallen finden, und es wird ihn erleichtern, dass die V2-Sekte
mit
fest entschlossener Skrupellosigkeit und erschreckend großem
Erfolg
alles daran setzt, die Bücher, in denen die Wahrheit steht, zu
vernichten.
Ein Buch, das vor weniger als fünfzig Jahren noch als
"weitverbreitet"
bezeichnet wurde, ist heute praktisch unauffindbar und vergessen. Da
hier
nur etwa die erste Hälfte veröffentlicht wird, empfehlen wir
jedem, nach Möglichkeit noch ein Exemplar dieses kostbaren
Büchleins
zu kaufen. Wir haben zwar vor, auch den zweiten Teil einmal zu
veröffentlichen,
aber wann und ob uns dies möglich sein wird, wissen wir nicht
genau.
Mit dieser Publikation leisten wir einen weiteren Beitrag gegen das
Vergessen und / oder das Verzerren der Wahrheit über den
Hitler-Terror.
Möge der Text helfen, die Leiden der gegenwärtigen Zeit, z.B.
den Terrorakt des Landgerichts Bonn, besser
zu verstehen, und der Ausbreitung von Wahrheit und Gerechtigkeit in
Liebe
dienen.
VORREDE
Unmittelbar vor den Toren der Stadt Weimar erhebt sich der
Thüringer
Wald in sanften Wellen zu einer Anhöhe, die im großen
Ettersberg
das freundliche Tal 250 Meter überragt. Etwa sieben Kilometer von
der Stadt der großen Dichter, Denker, Komponisten und Maler
entfernt
liegt die Kuppe des Aussichtsberges, in dessen grünen
Waldhängen
die Großen von Weimar einst Erholung und geistige Entspannung
fanden.
Seit dem Juli 1937 baute man auf diesen Höhen, auf denen der Geist
versunkener Größe lebte, eine Stadt des Grauens, ein
Konzentrationslager,
das man nach den uralten Baumbeständen Buchenwald nannte. Mitten
im
Lager steht noch ein mächtiger Baum, die Goethe-Eiche, in deren
Schatten
der Dichterfürst oft geweilt.
Die ganze Welt ist gegenwärtig aufgerüttelt durch die
Tatsachenberichte
über die Konzentrationslager, von einer rohen und unmenschlichen
Zeit
kurzweg "K. Z." genannt. Bücher in ungezählten Auflagen,
Filme
und Rundfunkberichte werden der Menschheit das Inferno vor Augen
halten,
in das Millionen von Menschen verstoßen waren. Buchenwald, das
ich
vom November 1938 bis November 1940 erlebte, ist eine traurige
Berühmtheit
geworden. Dies kleine Buch hat sich nicht zur Aufgabe gesetzt, Qualen
und
Todesnot zu schildern, die blutigen Pfade entmenschter Brutalität
wieder zu gehen. Es will den Versuch wagen, das religiöse Leben im
K. Z. darzustellen, den Spuren der Gnade zu folgen, die gläubigen
Menschen in den härtesten Jahren ihres Lebens eine geheimnisvolle
Kraft gab. Diese Schilderung von Ereignissen und Erfahrungen,
niedergeschrieben
viereinhalb Jahre nach ihrem Erleben, soll nicht das religiöse
Ringen
und Erleben in seiner ganzen Tragik, auch nicht in der Größe
der Gnade, die es durchflutete, darstellen. Sie kann auch nicht
Anspruch
darauf erheben, als allgemeingültiger Bericht zu gelten. Jedes
Lager
hatte ein anderes Gepräge. Selbst im gleichen Lager änderten
sich alle Voraussetzungen oft schlagartig in Tagen, oder langsam
während
mehrerer Wochen. Sie soll nur eine Wiedergabe von Erlebnissen in einem
verhältnismäßig kleinen Kreise sein, die auch wieder
zeitbedingt
waren. Sicher gab es Lager, in denen es noch schwieriger war, ein
religiöses
Leben zu gestalten als in Buchenwald und sicher gab es in Buchenwald
Zeiten,
die sich ganz anders auswirkten als die Jahre 1938 bis 1940, die ich
kennenlernte.
Man darf auch kaum einen Vergleich ziehen mit freiem seelsorglichem
Wirken
und sei es unter größten Hemmungen, unter äußeren
und inneren Schwierigkeiten. Die seelsorgliche Betreuung der
Häftlinge
im K. Z. war niemals ein Problem menschlichen Könnens oder
seelsorglicher
Erfahrung, es war ein Geschenk der Gnade oder, wenn man so sagen will,
des Charismas, einer außergewöhnlichen,
übernatürlichen
Gnadengabe, die einst Kennzeichen der Urkirche war. Mit heiliger
Ehrfurcht
fühlte die kleine Gemeinde oftmals die beglückende
Gewißheit
des Wortes: Der Geist weht, wo er will. Der gute Hirte ging seinen
Schäflein
auch in das Dorngestrüpp des K. Z. nach.
Es gibt nicht nur ein Christentum in der Bannmeile der Not in den
Vorstädten
der Großstadt, es gab auch in erschütternder Innigkeit ein
Christentum
im K. Z. Darum soll dieses Büchlein den Titel führen:
"Christus
im K. Z." Vor meinen Augen stehen die vom Geheimnis der Gottesnähe
durchrauschten verborgenen Winkel des Buchenwaldes, die belebte
Lagerstraße,
wo neben einem dröhnenden Schwall gotteslästerlicher
Flüche
das Wort Gottes gehaucht wurde. Vor mir stehen die aufrechten Gestalten
der Todgeweihten, die mit seelischer Größe dem qualvollen
Ende
entgegenschauten, begnadet mit dem Geiste des Martyriums. Ihnen, die
von
uns gingen in einem unsagbar einsamen Sterben, mit denen wir Priester
Christus
im K. Z. erlebten, sei dieses Büchlein gewidmet.
Nach einer knappen Darstellung allgemeiner Natur will ich versuchen,
einzelne Erlebnisse zur Kennzeichnung des religiösen Lebens im K.
Z. anzuführen. Es sind nur einige charakteristische
Einzelschicksale,
die sich tief in das Gedächtnis eingeprägt haben, die kein
Abstand
der Zeit in ihrem wesentlichen Inhalte abschwächen oder
auslöschen
kann. Zugleich sollen sie eine dankbare Erinnerung an markante
Persönlichkeiten
sein, die in der Glutesse dieses Lebens eine ganz besondere
Prägung
erhalten haben.
Die kurzen Aussprachen des dritten Teils wurden aus dem Gedächtnis
aufgezeichnet, da man im K. Z. Notizen weder machen noch bei sich
führen
oder gar bei der Entlassung mit herausbringen konnte. Bei der Fortdauer
der Überwachung, die immer wieder mit einer Hausdurchsuchung
verbunden
sein konnte, war es für mich auch nach meiner Entlassung und neuen
Verbannung durch das Gauverbot des Gauleiters von Salzburg nicht
ratsam,
mit der schriftlichen Vorbereitung von Erinnerungen an das K. Z. zu
beginnen.
So konnte ich dies kleine Buch im stillen und freundlichen Petting am
Waginger
See, wo ich als vertriebener Flüchtling wirklich eine neue, liebe
Heimat gefunden hatte, erst beginnen, als die Konzentrationslager mit
allen
Begleiterscheinungen auch für ihre ehemaligen Insassen ein Ende
gefunden
hatten. Aber trotz der Länge der Zeit lebten diese Stunden der
edelsten
brüderlichen Gemeinschaft so lebendig in mir, daß auch die
Wiedergabe
der Ansprachen ein treues Bild dessen bieten kann, was sie uns im Lager
waren.
DER STEINBRUCH DES HERRN
Wollte man ein Lehrbuch der Pastoral als Grundlage für die
seelsorgliche
Betreuung im K. Z. auswählen, wollte man dort nach Leitsätzen
und praktischen Anweisungen suchen, so würde man doch immer wieder
vor Fällen stehen, an die niemand hat denken können. Denn
alles,
was als selbstverständliche Voraussetzung, als notwendige
Vorbedingung
zu einem geordneten religiösen Leben und damit zu einer gelenkten
Seelsorge gehört und mit Recht verlangt wird, fehlte uns. Selbst
die
verzweigteste Kasuistik hätte seelsorgliche Fälle kaum
vorgesehen,
vor die man im K. Z. gestellt wurde.
Der Schutzhäftling im K. Z. war grundsätzlich ein rechtloser
Mensch. Er hatte keinen Anspruch auf einen Rechtsbeistand und seinen
Angehörigen
stand nicht das Recht zu, über ihn irgendeine Auskunft zu
erhalten.
Er war vogelfrei. Daß unter dieser Voraussetzung auch keinerlei
Rechtsanspruch
auf religiöse Betreuung bestand, die in jedem halbwegs gesitteten
Staatswesen keinem Schwerverbrecher verweigert wird, liegt auf der
Hand,
da die Einstellung des Dritten Reiches, das sein innerstes Wesen in der
Gestapo und SS offenbarte, von vornherein jede Voraussetzung für
irgendeine
religiöse Betreuung der Schutzhäftlinge im K. Z. unterband.
Ein
System, das jede Grundlage der Menschlichkeit mit brutalem Zynismus
zertrat,
kümmerte sich nicht um seelische oder religiöse
Bedürfnisse
von Millionen Menschen und Volksgenossen, die nach Auffassung der
Verantwortlichen
der Vernichtung überantwortet werden sollten. So wurden die K. Z.
der schlagende Beweis für eine der größten
Propagandalügen,
die immer wieder vom positiven Christentum des Dritten Reiches sprach.
Die Prätorianer Neros in den mamertinischen Kerkern, die
vielleicht
die seelische Größe der Urchristen bewunderten, die den
Apostel
Paulus seine Briefe diktieren sahen, waren Idealgestalten
gegenüber
den Schergen der SS in den Katakomben des 20. Jahrhunderts, in den
Konzentrationslagern.
Niemals wurde allerdings ein Verbot religiöser Betätigung
oder seelsorglichen Wirkens erlassen. Das wäre ja unvereinbar
gewesen
mit der anfangs zur Schau getragenen positiven Einstellung zu den
christlichen
Kirchen. Aber in der praktischen Auswirkung des beabsichtigten und
feige
verschleierten Vernichtungsfeldzuges gegen das Christentum war
religiöse
Betreuung im K. Z. mit der Todesstrafe belegt, die ohne Verhandlung,
ohne
Gerichtsverhör, ohne Verantwortungsmöglichkeit in den Bunkern
der SS oder in den Himmelfahrtskommandos vollstreckt wurde.
Ich erinnere mich noch klar an das letzte Beisammensein mit dem
herzensguten
und opferbereiten Pfarrer Otto Neuruhrer aus Götzens in Tirol. Ein
Häftling war an ihn herangetreten mit der Bitte, mit der Kirche
ausgesöhnt
zu werden oder wieder in die Kirche eintreten zu dürfen. Neuruhrer
war im Zweifel, ob er die notwendigen Vollmachten habe und wollte sich
mit mir darüber beraten. Da aber jeder Schutzhäftling im K.
Z.
in ständiger Todesgefahr schwebte, war darüber kein
vernünftiger
Zweifel möglich. Ich machte den seeleneifrigen Kameraden noch
aufmerksam,
ob er auch gewiß sei, mit wem er es zu tun habe, ob ihm nicht
irgend
jemand eine Falle gelegt habe, um eine Unterstützung zu erhalten
oder
vielleicht noch Schlimmeres plane. Lächelnd schaute er mich mit
seinen
treuen Augen an und sagte in seinem priesterlichen Eifer und in der
Freude
über einen großen Erfolg priesterlichen Wirkens: "Ich bin
mir
ganz sicher." Ich wünschte ihm Glück und ahnte nicht,
daß
er mir zum letzten Mal die Hand gedrückt hatte. Er war einem
Provokateur
in die Hände gefallen.
Schon nach wenigen Tagen wurde er mit dem Pfarrer Spannlang aus
Oberösterreich
an das Tor gerufen. Da sonst nichts vorlag, hofften manche Freunde, es
könnte für beide die Stunde der Freiheit schlagen. Mich
befiel
eine bange Ahnung um ihr Schicksal, die sich in wenigen Stunden
bestätigte.
Beide waren in den Bunker, das berüchtigte Lagergefängnis,
übergeführt
worden. Nach 48 Stunden ging schon wie ein Lauffeuer die Nachricht
durch
das Lager: Pfarrer Neuruhrer ist tot. Und einen Tag später ereilte
den Pfarrer Spannlang das gleiche Schicksal. Niemand erfuhr, in welchem
Zusammenhang sein tragischer Tod mit dem plötzlichen Hinscheiden
Otto
Neuruhrers stand. Als die braven Pfarrkinder in Götzens die Urne,
die die Asche ihres Pfarrers barg, in geweihte Erde senkten, ahnten sie
wohl nicht, daß ihr Seelenhirte sein Leben für die
Erfüllung
seiner priesterlichen Pflicht hingegeben hatte. Der Opfertod dieser
beiden
österreichischen Priester zeigt, wie seelsorgliches Wirken im K.
Z.
geahndet wurde.
Eine regelmäßige seelsorgliche Betreuung war nur
möglich,
wenn ein Priester oder ein wackerer Laienapostel als Häftling
unter
den Gefangenen war, wenn er das Unglück oder in diesem Falle das
Glück
hatte, von der Vorsehung in diesen Steinbruch des Herrn versetzt zu
werden.
Meist wurden die Priester, um die Pein des Lagerlebens zu erhöhen,
von den übrigen Häftlingen abgesondert, in Strafkompanien und
Isolierbaracken vom übrigen Lager getrennt, damit sie mit den
Häftlingen
des großen Lagers nicht in Berührung kamen. In Buchenwald
hatte
man von dieser Sonderbehandlung abgesehen und damit war eine
größere
Bewegungsmöglichkeit gegeben und gegenseitige
Anknüpfungsversuche
erleichtert.
Bei meiner Einlieferung in das Lager im November 1938 waren außer
mir noch zwei katholische Priester in Buchenwald. Ein Kaplan der
Diözese
Paderborn hatte schon eine kleine Gemeinde um sich gesammelt. Er war im
ganzen Lager, vor allem bei den politischen Häftlingen, sehr
beliebt.
Seine Erfahrung, sein kluges und mutiges Arbeiten bot wertvolle
Anregungen.
Ehe man, von Aussprachen unter vier Augen abgesehen, an eine
systematische
Tätigkeit schreiten konnte, mußte man sich in die
Lebensgewohnheiten
des Lagers einleben und alle Möglichkeiten und Voraussetzungen
sorgfältig
erwägen. Gefahren drohten ja von allen Seiten, nicht nur von der
Lagerführung,
auch von den Häftlingen.
Als ich am 16. November 1938 das Lager betrat, war ein Berufsverbrecher
Lagerältester (Vertreter der Häftlinge gegenüber der
SS-Lagerführung).
Seine Roheit war lagerbekanat. Er verprügelte seine Mitgefangenen
und trug immer einen Knüppel bei sich. Mit einer Flut von
Beschimpfungen
und nicht wiederzugebenden Anpöbelungen begrüßte er den
Pfaffen Steinwender und teilte ihn dem Wohnblock zu. Alsbald stellte
sich
jedoch heraus, daß die politischen Gefangenen Kameradschaft zu
halten
wußten, wenn man sich selbst bemühte, ein guter Kamerad zu
sein.
Etwa ein Viertel der zu meiner Zeit durchschnittlich 15.000 bis 20.000
zählenden Insassen des Lagers trug den roten Winkel der
politischen
Häftlinge. Sie stellten die eigentliche Klasse der "Staatsfeinde"
und bestanden zu 80 Prozent aus Kommunisten. Die übrige
Gesellschaft
war mehr als gemischt. Vom harmlosen Bettler bis zum
gemeingefährlichen
Strolch trugen sie den schwarzen Winkel der Asozialen. Die zahlreichen
Juden waren gekennzeichnet durch den gelben Zionsstern mit den
Unterscheidungen
in politische und asoziale Häftlinge.
Die besonders gehaßten Bibelforscher, etwa 400 durchweg aufrechte
Menschen und willensstarke Charaktere, hatten den violetten Winkel.
Dazu
kamen noch die kleineren Gruppen der Zigeuner (brauner Winkel), Polen
(brauner
Winkel mit P), Homosexuellen (rosaroter Winkel), Emigranten (blauer
Winkel),
ehemaligen Mitglieder der SS (roter Winkel auf beiden Seiten der Bluse)
und der Berufsverbrecher (grüner Winkel). In den Arbeitskommandos
fanden sich Gefangene aller Kategorien, die Wohnblocks waren nach
Winkeln
gesondert. Das Zusammenleben mit den Menschen dieser mehr als bunten
Zusammensetzung
brachte naturgemäß oft besondere Härten. Und trotzdem
schwebte
bei aller Gegensätzlichkeit der Weltanschauung, der Erziehung, des
Charakters und des Berufes über allen das erbarmungslose
gemeinsame
Schicksal. Daß Landsleute in besonders herzlicher Kameradschaft
verbunden
waren, liegt auf der Hand, ebenso kamen Stammesgegensätze
besonders
zwischen Norden und Süden oft drastisch zum Ausdruck. Zur Ehre der
österreichischen Häftlinge sei gesagt, daß sie fast
alle
gute Kameraden unter sich und allen anderen gegenüber waren.
Daß
der Attentäter Jawurek, der am Wiener Südbahnhof
Bundeskanzler
Seipel angeschossen hatte und als asozialer Häftling im Lager war,
öfter die Kameraden und Landsleute aus Österreich um eine
Zigarette
bat, mag als charakteristische Groteske des Lagerlebens verzeichnet
werden.
Aus dieser Zusammenstellung allein ist schon ersichtlich, daß
beim größten Teil der Gefangenen keinerlei oder nur wenig
religiöses
Bedürfnis vorhanden war. Einem von Staats wegen vorgesehenen
Seelsorger
wäre es sicher schwer gefallen, sich einigermaßen
erfolgreich
durchzusetzen.
Die ersten Kameraden, die sich zu einem religiösen Zirkel
zusammenfanden,
waren die Landsleute, in unserem Falle die Österreicher, unter
ihnen
die Salzburger, die für die Freiheit ihrer Heimat bis zur letzten
Stunde gekämpft hatten, Kameraden, die zum Teil schon an den
Sönntagsfeiern
in den Zellen der Gestapo in Salzburg teilgenommen hatten. Dazu kamen
Freunde
und Bekannte aus Wien und den anderen österreichischen
Bundesländern
und neue Freunde aus dem Altreich. Einer fand bald zum andern und nach
wenigen Wochen war der Plan einer gemeinsamen Gestaltung des Sonntages
und eines gemeinsamen Erlebens des Kirchenjahres spruchreif und wurde
mit
bescheidensten Mitteln durchgeführt.
Wie groß die Schwierigkeiten waren, die sich der
Durchführung
dieses Planes entgegenstellten, geht daraus hervor, daß keinerlei
seelsorgliche Mittel zur Verfügung standen. Wir hatten keine
Kirche,
keine Kapelle, keinen religiösen Raum für die 20.000
Häftlinge
und es war ausgeschlossen, das bescheidenste Gelaß für
Kultzwecke
instandzusetzen. Wie froh wären wir nur um eine Scheune oder um
einen
leeren Schafstall gewesen! Es gab kein Kruzifix und kein
religiöses
Bild, weder ein Brevier, eine Heilige Schrift, ein Missale oder sonst
ein
religiöses Buch. Als wir nach langem Suchen die Sonntagsevangelien
aus dem Gedächtnis zusammengestellt hatten, konnten wir zwei beim
besten Willen nicht herausbringen. Der schon erwähnte Kaplan aus
Paderborn
brachte es zustande, durch eine verdeckte briefliche Anfrage in der
Heimat
auch diese letzte Lücke auszufüllen. Uns fehlte kurz gesagt
alles,
was sonst selbstverständliche Voraussetzung für
religiöse
Feiern ist, auch der Mittelpunkt religiösen katholischen Lebens,
das
Meßopfer, das Brot des Lebens und der Gnadenstrom der Sakramente.
Die Abgelegenheit des Lagers auf dem Berge brachte es mit sich,
daß
wir auch aus den benachbarten Dörfern, deren Kirchtürme wir
wohl
sahen, niemals eine Glocke läuten hörten..
Die Lagerordnung und die Lagerarbeit erschwerten vor allem jede
religiöse
Zusammenkunft. Die Wochentage und die auf Wochentage fallenden
kirchlichen
Feste, wie Erscheinung des Herrn und Fronleichnam, waren restlos mit
schwerer
Arbeit oder sonstiger Lagerbeschäftigung ausgefüllt.
Untertags
war ein Zusammentreffen ausgeschlossen, ausgenommen die Arbeit, die
Kameraden
an derselben Arbeitsstätte zusammenführte. So blieb praktisch
nur der Sonntag oder zu Ostern und Weihnachten der zweite Feiertag, der
meistens arbeitsfrei war. Oft hatte man aber auch gerade am
Sonntagvormittag
eine "freiwillige Arbeit" angesetzt. Wer sich an dieser sogenannten
freiwilligen
Sonntagsfron nicht beteiligte, wurde mit schweren Strafen belegt. So
marschierte
der größte Teil der Lagerinsassen auch am Sonntagvormittag
bei
jedem Wetter in den Steinbruch und schleppte auf den Schultern schwere
Steine oft kilometerweit zu irgend einem Straßenbau. So war eine
kurze, besinnliche Sonntagsfeier am Morgen schon nicht mehr
möglich
und es fand sich nur noch in den wenigen Nachmittagsstunden Zeit, wenn
nicht auch die durch einen Kleiderappell, durch ein strafweises
Antreten
auf dem Appellplatz oder eine andere Schikane ausgefüllt waren. Da
uns ein ständig benutzbarer Raum fehlte, mußten wir mit
größter
Sorgfalt vorgehen, denn die Überwachung der Häftlinge war
äußerst
streng. Außerdem mußte man bei der Zusammensetzung des
Lagers
vor den Mithäftlingen auf der Hut sein. Es gab immer Denunzianten,
die sich durch ihre Angeberei eine Verbesserung der eigenen Lage
erhofften,
und gehässige Menschen, denen der Zweck unseres Zusammenkommens
ein
Greuel war.
Es gab Spione und Lauscher, vor denen man besonders auf der Hut sein
mußte. Es blieb daher nichts übrig, als ein verstecktes
Plätzchen
hinter einer Baracke oder im Walde zu suchen und den Ort der
Zusammenkunft
immer wieder zu wechseln. So saßen wir im Sonnenschein um irgend
einen Baumstrunk oder standen im Regen oder Schneesturm unter den
Bäumen
und hielten unsere Sonntagsfeiern. Selbstverständlich waren immer
Kameraden als Wachposten aufgestellt, die jedes verdächtige Nahen
eines SS-Mannes oder eines unsicheren Häftlings melden
mußten,
denn der Zweck unseres Beisammenseins mußte getarnt werden. In
möglichst
nachlässiger und bequemer Haltung saßen wir herum und
rauchten
Zigaretten, wenn es welche gab, um den wirklichen Charakter unseres
Treffens
nach außen hin zu verschleiern. Die gute Kameradschaft mit den
meisten
der politischen Häftlinge, die großenteils Kommunisten
waren,
kam uns dabei zugute. Viele wußten genau, was uns
zusammenführte,
doch niemals wurde unser Kreis gestört oder gar verraten. Mehr als
einmal kam es vor, daß jemand mir im Wohnblock sagte: "Deine
Leute
warten schon auf dich." Mehr als einmal wurde ich aufmerksam gemacht,
auf
diesen oder jenen Mithäftling zu achten, dem man eine schuftige
Handlung
zutrauen könnte. Nicht selten geriet auch unabsichtlich ein
Unberufener
in unsere Runde. Dann mußten wir sofort abbrechen und einen
raschen,
unverfänglichen Übergang auf ein harmloses Thema finden.
Die äußeren Hindernisse waren nicht immer gleich groß.
War dicke Luft im Lager und zeigte das Stimmungsbarometer des
Lautsprechers
am Tore Sturm, dann war doppelte Vorsicht geboten. An solchen
kritischen
Tagen mußten sich die einzelnen Priester darauf beschränken,
mit zwei oder drei Kameraden in der Form eines lässigen
Spazierganges
auf der stark begangenen Lagerstraße oder auf Waldwegen den
Sonntag
zu feiern. War .ein solcher Sonntag arbeitsfrei, dann waren fast alle
Priester
vom frühen Morgen bis zum späten Abend beschäftigt, um
die
meisten Mitglieder der kleinen Gemeinde erfassen zu können, denn
mehr
als sieben bis zehn Gefangene konnte man aus begreiflichen Gründen
auch an ruhigen Tagen nicht zugleich erfassen. Eine Ausnahme bildete
die
Christkönigsfeier am Christkönigsfest 1939, wo 25 Kameraden
in
der Arbeitsbude eines Kommunisten zu einer besonders stimmungsvollen
Feier
beisammen waren.
Der Kreis der in dieses gemeinsame religiöse Leben Einbezogenen
konnte nicht groß sein. Erst als bei Kriegsbeginn ein
größerer
Zugang von Priestern aus dem vorübergehend für andere Zwecke
bestimmten Dachau erfolgte, bildete sich bald um jeden Priester eine
kleine
Gemeinde. Fast zur gleichen Zeit kamen mit etwa 800 tschechischen
Intellektuellen
auch 20 Priester in das Lager, die sich um ihre Landsleute
kümmerten.
Unter ihnen war ein Domherr aus Olmütz, der als
Schutzhäftling
von Buchenwald zum Weihbischof seiner Diözese ernannt und auf
Grund
dieser Ernennung entlassen wurde. Die Kriegsereignisse in Polen
führten
dann Hunderte von polnischen Priestern in das Lager, Hunderte wurden in
der Heimat erledigt. Von diesen polnischen Priesterkameraden kehrten
wohl
die wenigsten in ihren Wirkungskreis in der Heimat zurück. Soweit
es bei der außerordentlichen Härte der Behandlung
möglich
war, nahmen sie sich ohne Zweifel um die religiösen
Bedürfnisse
der Polen an, die fast alle mit dem Rosenkranz in das Lager kamen.
Alle, die sich zu solch einer kleinen, religiös ausgerichteten
Gemeinschaft gefunden hatten, verband neben der großen
Schicksalsgemeinschaft
des Lagers eine besonders herzliche Freundschaft. Da gab es keinen
Unterschied
des Standes. Alle trugen nicht nur die gleiche Uniform des Gefangenen,
sie waren wirklich, wie es in der Urkirche hieß, ein Leib und
eine
Seele.
War es auch ein gar karges Brot, das das religiöse Leben fristete,
so barg es offensichtlich das Charisma des Geistes, der durch seinen
besonderen
Beistand in all den außerordentlichen Schwierigkeiten die Seele
nicht
untergehen ließ. In allen Stürmen des
menschenunwürdigsten
Lebens, das man sich denken kann, fanden sie sich wie Brüder in
gemeinsamer
Not zusammen. Ob sich ein Minister mit einem Bauer fand, ein
Intellektueller
mit einem Arbeiter, sie alle verband der gleiche Glaube, das gleiche
Vertrauen
auf die Vorsehung Gottes.
Nicht über jedem Sonntag lag Sonnenschein. Es gab Tage und Wochen,
in welchen sich alle Widerwärtigkeiten wie ein Unwetter über
allen oder einzelnen zusammenballten und die Widerstandskraft zu
zermürben
drohten. Zeiten des Hungers, wüster Ausschreitungen, sadistischer
Quälereien sexuell pervers veranlagter Aufseher, ohne jede
Aussicht
auf Änderung. Im März 1939 erließ Himmler eine
Verlautbarung
über eine Amnestie für politische Häftlinge der Gestapo
und in den Konzentrationslagern, die anläßlich des
Jahrestages
des Einmarsches in Österreich erfolgen sollte. Man sah uns
Österreicher
schon in der Heimat. Doch im Lager brach die Ruhr aus und brachte
Sperre
für Entlassungen. Im April 1939 wurden anläßlich des
50.
Geburtstages des Führers in Buchenwald allein fast 2000 zumeist
politische
Häftlinge in Freiheit gesetzt. Ein Entlassungstaumel erfaßte
das Lager, eine wilde Parole jagte die andere. Tagelang traten wir
schon
vor drei Uhr früh zum Morgenappell an, bei dem die langen Listen
der
Entlassenen verlesen wurden. Jeder wartete in fieberhafter Spannung auf
seinen Namen. Immer leerer wurden die Wohnblocks, immer kleiner die
Arbeitskommandos,
der Appell und die Listen der Freiheit immer kürzer. Das
Hoffnungsbarometer
sank. In den leer gewordenen Wohnräumen bei den fast unbesetzten
Tischen
saßen die Zurückgebliebenen mit düsteren Mienen. In
wenigen
Tagen war die Aktion beendet. Zweimal war unsere Hoffnung
enttäuscht.
Nun mußten wir damit rechnen, lange Jahre lebendig begraben zu
sein,
wenn wir die Freiheit überhaupt erlebten. Bald kamen neue
Zugänge,
die leer gewordenen Plätze füllten sich wieder und all unsere
Hoffnung war dahin.
Wer könnte es leugnen, daß solche Zeiten der bittersten
Enttäuschung, besonders wenn Vernichtung und Peinigung mit
erneuter
Wut einsetzten, die härtesten Proben auch an die Glaubenskraft und
an das Vertrauen auf ein göttliches Walten im Menschengeschehen
stellten.
Jeder Schutzhäftling im K. Z., der nicht zum dumpf
dahinbrütenden
Tier herabgesunken war, lebte eine menschliche Tragödie im
wirklichen
Sinne des Wortes.
Bald kam dieser, bald jener Kamerad mit weithin sichtbaren Spuren
grober
Mißhandlungen zu den schlichten sonntäglichen Feiern. Dann
blieb
lange die Post mit den Berichten der Angehörigen aus, auf die man
wartete wie auf einen Sonnenstrahl nach langen, langen Regenwochen.
Oder
ein angetrunkener, übelgelaunter Scharführer warf vor den
Augen
der bange wartenden Häftlinge die Post in den brennenden Ofen.
Dann
wieder riß der grausame Lagertod Lücken in den
Freundeskreis,
wenn die Feme wütete, oder man bangte um das Leben eines guten
Kameraden,
von dem man spürte, daß seine Vernichtung beschlossen sei.
Wie
ein Tier instinktiv Gefahr und Todesnähe wittert, so fühlten
auch manche, dem Tode geweihte Häftlinge, wenn sie in den
Steinbruch
oder in ein anderes Todeskommando versetzt wurden, wenn eine Vernehmung
die andere jagte, die Todesschatten über ihrem Haupte. Es war, als
ahnten sie es, wenn irgendeine Stelle in der Heimat aus Neid oder
Furcht
ihre "Erledigung" veranlaßte und es nicht erwarten konnte, bis
die
Urne mit der Asche als ungefährlicher Rest in die Heimat kam,
begleitet
von einer feigen Meldung, der Häftling sei an Herzschwäche
nach
Ruhr oder einer anderen harmlosen Krankheit gestorben. Dieses Bangen um
das Leben der besten Freunde und Kameraden brachte uns bittere Stunden.
Jeder Gefangene konnte ja der nächste sein, dessen Überreste
dem Feuer des Krematoriums übergeben wurden. Doch daneben gab es
auch
erhebende Augenblicke in Stunden der Gnade. Sonntage und Festtage haben
uns durch ihre ergreifende Schlichtheit manchmal tiefer ergriffen als
die
ganze Schönheit und Würde eines zur Gewohnheit gewordenen
feierlichen
Gottesdienstes in einer festlich geschmückten Kirche. Weihnachten
erlebten wir, aller irdischen Habe beraubt, unbetreut von einer
liebenden
Hand, wie die Hirten vor der Krippe, und feierten Ostern, in denen uns
das Alleluja des Auferstehungsmorgens in der Seele klang wie starkes
Hoffnungsgeläute
aus einer anderen Welt.
Aber es kamen dann wieder Zeiten, in welchen die Härte des
Schicksals
auch in die Tiefen der Seele fraß und alle lichten Sterne
auszulöschen
schien. Nur wer es an sich und vielleicht noch mehr an anderen erlebt
hat,
welche seelische Prüfung und Erschütterung das Lagerleben in
seiner völligen Rechtlosigkeit und ständigen Todesdrohung mit
sich bringen konnte, wird es verstehen, daß die seelsorgliche
Betreuung
oftmals nichts anderes war als eine Bewahrung vor dem Sturz in den
Abgrund.
Man denke sich hinein in die Lage eines braven Familienvaters, der als
Wachebeamter nur seine Pflicht erfüllt, nie einem Menschen etwas
zuleide
getan hatte. Vom ersten Tage seiner Einlieferung an war er in der
Strafkompanie.
Während der jahrelangen Haft erhielt er keine Nachricht von seiner
Familie, nicht die geringste Geldzuwendung für kleine,
zusätzliche
Bedürfnisse war ihm gestattet, er durfte den Seinen keinen Brief,
kein Lebenszeichen senden. In der Strafkompanie oblag ihm die
härteste
Arbeit und er war der ärgsten Quälerei ausgesetzt. Jeden
Sonntag
stand er statt des Mittagessens stundenlang bei jeder Witterung am
Tore,
jede Arbeit mußte im Laufschritt erledigt werden. Drei Jahre trug
er diese Qual, bis er sein Leben lassen mußte. Wenn ein solcher
Häftling,
wenn ein solcher bis ins tiefste Wesen katholischer Mann bei diesem
Leben,
dessen Not alle Grenzen des Ertragbaren übersteigt, noch die
Seelengröße
aufbringen kann, jede Möglichkeit zu suchen, um sich bei unseren
schlichten
Andachten einzufinden und das seelische Gleichgewicht nicht zu
verlieren,
so ist das ein Heldentum, vor dem man sich nur in Ehrfurcht beugen
kann.
Wie klein mußte man sich fühlen, wenn er in den letzten
Minuten
des Sonntags nach einer Strafarbeit mit durchnäßten Kleidern
kam, um auch in diesen Sonntag noch einen Schimmer religiöser
Erhebung
zutragen. Als die Urne mit der Asche dieses Helden in die Heimat
gekommen
war und auf die Beisetzung in geweihter Erde harrte, hielten seine
Söhne,
die ihn jahrelang nicht gesehen, in der Uniform der deutschen
Wehrmacht,
geschmückt mit den Auszeichnungen für ihre Tapferkeit, die
Totenwacht,
ein erschütterndes Bild des tragischen Unheils, in das Volk und
Heimat
gestürzt worden waren. Das Leiden unseres unvergeßlichen
Georg
Lexer aus Kärnten möge zeugen dafür, daß es im
Leben
aller, die dort waren, manche Augenblicke gegeben hat, die ein hartes
Ringen
mit der Gnade waren, und wir dürfen den Herrn dankbar preisen,
daß
er keinen aus unserem Kreise in der höchsten Not, in den
härtesten
Jahren des Lebens seelisch zusammenbrechen ließ, daß keiner
an seinem Herrgott irre geworden ist.
Wenn wir trotz der gewaltigen Schwierigkeiten doch noch in einem zur
Größe des Lagers zwar verhältnismäßig
kleinen
Kreise ein wirklich religiöses Leben aufrechterhalten konnten, so
war das nur ein Werk der Gnade und des Gebetes der Heimat, das in
ungezählten
Briefen als tröstliche Botschaft zu uns drang. Diese
unzerreißbare,
oft sichtbar erlebte Gemeinschaft war ein mächtiger Auftrieb
unserer
seelischen und körperlichen Kräfte. Es war daher eine
Selbstverständlichkeit,
diese mächtigen Trostgedanken möglichst stark einzubauen und
auszuwerten. Wir waren ja keine Kirchengemeinde im gewohnten Sinne, wir
hatten kein Gotteshaus, keinem Bischof war es möglich, uns seine
Hirtensorge
angedeihen zu lassen. Uns vereinte nur der gemeinsame Glaube und die
gemeinsame
Not.
Was konnte das Gemüt stärker erheben als der Gedanke der
immerwährenden Zugehörigkeit zur Pfarrgemeinde in der Heimat?
Der Schutzhäftling im K. Z. war polizeilich in der Heimat nicht
abgemeldet.
Noch weniger aus den Herzen derer entschwunden, die mit ihm
fühlten,
die mit ihm wußten, daß er ein großes Opfer für
die Heimat brachte. Darum gab es kaum einen Gedankenaustausch, kaum
eine
Ansprache, die nicht an das Pfarrleben in der Heimatgemeinde, an die
kirchlichen
Heimatbräuche anknüpfte. Waren wir ohne Kirche, ohne Altar
und
ohne Meßopfer, so dachten wir daran, daß wir in die
Gebetsmeinung
der heimatlichen Pfarrmesse eingeschlossen waren, die jeden Sonntag und
jeden Festtag für die ganze Pfarrgemeinde, also auch für uns
abwesende Brüder gelesen wurde. So läutete auch uns eine
Wandlungsglocke,
so lebten auch wir in einer heiligen Gemeinschaft, die uns untrennbar
mit
der Heimat verband. Wir bauten die Gedanken, die uns über das
trübe
Elend hinausheben sollten, auf das Kirchenjahr auf und dieses suchten
wir
mit der Heimat zu erleben. Wir hörten die Adventglocken über
die verschneiten Berge und Fluren zum Rorate laden, wir standen vor der
Weihnachtskrippe der Heimatkirche, wir sahen in der Osternacht die
Osterfeuer
unserer Lungauer und Kärntner Heimat über die Höhen und
in die Täler leuchten, wir machten den Gang zur Auferstehung mit
und
in unseren Seelen lebte die Osterfreude der Heimat. Wir baten um das
tägliche
Brot mit den Bauern der Heimat, wenn sie in den Bittgängen um den
Segen für die Feldfrüchte flehten. Wir gingen mit der
Fronleichnamsprozession
durch die blühenden Ährenfelder und duftenden Wiesen, wir
standen
zu Allerseelen mit an den Gräbern der teuren Toten. Diese
Gewißheit
half uns bei der geistigen Erhebung aus dem Elende, das uns lauernd
umgab.
So wurden wir hinter den mit Starkstrom geladenen Drahtzäunen und
den Maschinengewehrtürmen des K. Z. vielleicht treuere und
dankbarere
Glieder der Heimatpfarre als wir es waren, da wir ohne die Not eines
harten
Daseins ihre starken Lebenskräfte vielleicht viel zu wenig
achteten.
Diese besonderen Voraussetzungen für das seelsorgliche Wirken
im K. Z. stellten den Priester, der neben der Lagerarbeit und der
Beanspruchung
mit den eigenen Sorgen den ständigen Kontakt mit seiner kleinen
Gemeinde
aufrechterhalten wollte, ganz auf sich allein. Er hatte oft weder Zeit
noch Gelegenheit zu einer eingehenden Aussprache mit einem
Priesterkameraden.
Er hatte weder Zeitschrift, noch Buch, noch lebendige Verbindung mit
dem
großen kirchlichen Leben. Es kam kein Hirtenbrief eines Bischofs
zu uns, so gerne unsere Oberhirten uns ein Wort des Trostes geschickt
hätten.
Wir konnten keinen Bischof um Rat fragen oder um Entscheidung und
Weisung
bitten, sondern wir mußten in rascher Entschlußkraft selbst
in schwierigsten Fällen alle Entscheidungen treffen, die in der
normalen
Seelsorge viel Studium oder manche Rückfrage beansprucht
hätten.
Die ständige Todesgefahr machte ja in jedem Falle die Frage nach
der
Vollmacht zur geringsten .Schwierigkeit. Sicher war der Grundsatz eines
großen Theologen und Heiligen, der vielleicht zu wenig beachtet
wird,
kaum irgendwo angebrachter als im K. Z.: Epikie (selbstverantwortliche
Entscheidung) ist eine Tugend.
Die eigene trostlose Lage brachte manche Belastung mit sich. Es kostete
viel Kraft, sich selbst auf der Höhe zu erhalten, wenn auch ein
besonderer
Schutzengel treue Wache hielt. Über den Ereignissen des
Lagerlebens
zu stehen, das jeden Häftling bis in die kleinsten Dinge des
täglichen
Lebens einschneidend traf, ging oft fast über alles Vermögen.
Und doch mußte man über diese inneren Schwierigkeiten
hinwegkommen,
wollte man anderen helfend und beratend . beistehen, wollte man einige
Sonnenstrahlen in von Sorge und Not umdüsterte Herzen tragen. Aber
gerade an solchen Tagen, an welchen das eigene innere Gleichgewicht ins
Wanken zu geraten drohte oder eine persönliche Belastung aus dem
Lagerleben
eine lastende Stimmung schuf, pflegte oft ein anderer, der
Tröster,
den der Herr den Seinen für die Tage der Trübsal und der
Verfolgung
im Abendmahlsaale versprochen hatte, die Gabe des Trostes zu geben und
die Gnade des richtigen Wortes zur richtigen Stunde zu schenken, denn
es
fehlten uns ja nicht nur die primitivsten Behelfe, es fehlte uns auch
die
Zeit zu einer längeren Vorbereitung. Wer hätte sich Notizen
oder
eine sichere Skizze machen können? So war das Gebet: Komm,
Heiliger
Geist! eine Anrufung, die wohl inständiger nie gebetet wurde als
hier.
Der Verlauf unserer kurzen Sonntagsfeier war so einfach wie ihre
Vorbereitung
und Zurüstung. Nach einem schlichten Einleitungsgebet, manchmal
nach
einer besonderen Gebetsmeinung, die durch die Zeitumstände und
persönliche
Anliegen bestimmt war, folgte die kurze Ansprache. An sie
schlössen
sich wieder kleine, vielfach vom Augenblick und seiner Sorge diktierte
Gebete, die mit dem Gebet des Herrn und dem Gedenken der Toten
abgeschlossen
wurden. Diese fast erschreckende Kargheit und Einfachheit allein schon
läßt ermessen, wie stark die Gnade sein mußte, die
unsere
Sonntage im K. Z. durchströmte.
Trotz aller noch so großen Hemmungen und Mängel bot dieses
Zusammenleben mit den Kameraden als gleichgestellte Häftlinge,
gleichgestellt
in allem, auch große Vorteile. Wir trugen die gleichen Kleider,
an
denen der Schmutz der Arbeit klebte, da sie ja nur zweimal im Jahre
gewechselt
wurden. Wir hatten den gleichen "Speckdeckel" auf dem Kopfe, schoben
den
gleichen Kohldampf, mußten alles miterleben, was nun einmal zum
K.
Z. gehört. Keiner von uns Priestern war sicher vor den
Schlägen
am Bock, vor dem grausamen Hängen am Baum, wir wälzten uns
beim
Strafexerzieren mit den übrigen Häftlingen über die
spitzen
Steinhaufen oder durch den Morast des Appellplatzes. Wir suchten wie
die
anderen über solche Situationen mit einem Stücklein guten
Humors
hinwegzukommen.
Bei den religiösen Zusammenkünften gab uns weder Stola noch
Meßgewand ein Zeichen gottesdienstlicher Würde und Aufgabe.
Wir waren, wenn wir so sagen wollen, wirklich in allem Brüder
unter
Brüdern. Wenn sich ein Priester Mühe gab, wirklich als guter
Kamerad zu leben, nicht auf eigene kleine Vorteile zu schauen, die
letzte
Zigarette mit den Kameraden zu teilen, wenn er keine noch so schmutzige
Arbeit scheute, dann war der Bann gebrochen, dann öffneten sich
ihm
die Herzen, die vielleicht vor einem ernsten Amtskleide verschlossen
geblieben
wären. So fanden Menschen unmittelbar in der gemeinsam erlebten
Not
zum Priester, Menschen, die ihn in der sauber eingerichteten
Amtswohnung
kaum gesucht oder gefunden hätten. Von allem Standesdünkel
befreite
uns die restlose Gleichheit in allem und die Tatsache, daß man
auf
uns Priester von oben ein besonderes Augenmerk geworfen hatte, das
keineswegs
von besonderem Wohlwollen zeugte. Für menschliche Eitelkeiten
besonderer
Standesrücksichten war hier wahrlich kein Platz und materielle
Motive
fielen von selber weg. Dazu kam, daß mancher Mitgefangene uns
Priestern
ein Beispiel von Glaubenskraft und Opferbereitschaft gab, das uns nur
erbauen,
und zur Nachahmung anspornen konnte.
So war das Leben im K. Z. eine harte, aber gute Schule für das
Verstehen der Seelennot, für das Suchen und Finden von Wegen zu
den
Menschenherzen, die uns sonst verschlossen geblieben wären.
Vielleicht
haben wir nie in unserem ganzen priesterlichen Leben und Wirken mehr
mit
den Augen Christi in Menschennot, Menschenschuld und Menschenleid
gesehen,
als in diesen Jahren. Wenn irgend einmal in den Sorgen eines harten
seelsorglichen
Wirkens das Wort des Völkerapostels galt: "Durch die Gnade Gottes
bin ich, was ich bin", dann traf es auf unser Wirken im K. Z. zu.
EINZELERLEBNISSE UND EINZELSCHICKSALE
DER LAGERALTAR
Gute Kameradschaft brachte es mit sich, daß ein Häftling
dem anderen gerne ein Zeichen der Aufmerksamkeit widmete. So dachte ein
Kommunist mir eine Freude zu bereiten, als er irgendwo auf der
Lagerstraße
ein kleines Ding fand, für das er keine Verwendung hatte. Da es
sich
nach dem äußeren Anscheine um eine religiöse Sache
handelte,
brachte er es mir mit der Bemerkung: "Ich weiß mit dem Dreck
nichts
anzufangen, vielleicht bedeutet es dir etwas." Zu meinem
größten
und freudigen Erstaunen überreichte er mir eine kleine Reliquie
vom
Sarge des heiligen Bruders Konrad in Altötting. An der Echtheit
war
kein Zweifel. Unfaßbar war nur, wie dieses wertvolle kleine
Heiligtum
ausgerechnet nach Buchenwald kam.
Bei der nächsten religiösen Zusammenkunft am folgenden
Sonntage
sagte ich meinen Kameraden: "Wir haben jetzt einen Altar einem Patrone
geweiht, der seine schützende Hand über unsere Heimat
hält."
Bei jeder Feier war nun diese Reliquie bei uns und ersetzte uns Altar
und
Gotteshaus. Schlichter und einfacher hätte das äußere
Zeichen
unseres Sonntagsgottesdienstes nicht sein können und doch
strömte
aus ihm der Hauch der Gnade, als stünden wir im Heiligtum von
Altötting,
zu dem Menschen von ferne her pilgern.
Ein Zufall gab es uns in die Hand, ein Zufall lüftete auch das
Geheimnis seiner Herkunft. In unserem Block waren drei reiche Berliner
Zigeuner, Vater, Sohn und Schwiegersohn. Alle drei waren
überzeugte
Katholiken. Niemals schnitt der alte Petermann ein Brot an, ohne vor
allen
Häftlingen drei Kreuze darüber zu machen. Ein zufälliges
Gespräch mit ihnen kam auf die Bruder-Konrad-Reliquie. Mit
großer
Erregung fragte der kleine Zigeuner, wer sie habe. Als ich sie ihm
zeigte,
fiel er mir um den Hals und war überglücklich, daß sie
in meiner Hand sei. Nun erfuhren wir ihre Geschichte. Alle drei
Zigeuner
waren von Berlin im eigenen Auto zur Seligsprechungsfeier Bruder
Konrads
nach Altötting gefahren. Als kostbares Andenken an diese erhebende
Feier nahmen sie diese kleine Reliquie mit, die sie immer bei sich
trugen
und auch in das Lager einschmuggeln konnten. Gerne gab ich ihm sein
Eigentum
zurück, das er uns jeden Sonn- und Festtag bereitwillig zur
Verfügung
stellte, wenn wir unter irgendeinem Baume oder in einem verborgenen
Versteck
des Lagers unseren Bruder-Konrad-Altar brauchten.
DAS LAGERMISSALE
Oft äußerten die Kameraden den brennenden Wunsch nach einem
Meßbuch, einem Missale oder einem Kleinen Schott, um das
Kirchenjahr
besser mitzuerleben, um die kraftvollen Gebete des Meßopfers in
unseren
darbenden Seelen wirken zu lassen. In die Zellen des Salzburger
Gestapo-Gefängnisses
konnten wir ein Missale hineinschmuggeln. Und wohl kaum einmal im
geordneten
bürgerlichen Leben hat der ernste und doch so zuversichtliche
Geist
der Kirchengebete so stark auf uns gewirkt, als bei den schlichten
Sonntagsfeiern
im Gebäude der Gestapo am Salzachkai in Salzburg. Das ferne
Läuten
der Kirchenglocken erinnerte uns an das gleichzeitige Meßopfer in
irgendeinem Gotteshaus und wir erlebten es in unseren Gedanken mit.
Wesentlich anders war es im Lager. Ein Missale war nicht zu beschaffen
und nie drang der feierliche Ton einer Kirchenglocke an unser Ohr.
Unsere
vollständig behelfslose Lagerliturgie war von geradezu
erschütternder
Einfachheit. Es war wahrlich oft nicht leicht, die eigene Seele zu
erheben
und die formlose Sonntagsfeier, besonders wenn das Barometer im Lager
auf
Sturm und Peinigung stand, wirkungsvoll zu gestalten und die seelische
Sonntagsruhe und einigen Trost aus übernatürlichen Quellen in
die Qual eines Lebens ohne Sonnenschein und Freude zu bringen.
Da kam ein treuer Kamerad aus unserer kleinen Gemeinde auf den
Gedanken,
es müßte doch möglich sein, die wesentlichen Gebete des
Meßopfers aus dem Gedächtnis niederzuschreiben. Ich wollte
ihm
eine Freude machen und mir selbst eine gründliche
Beschäftigung
mit dem Text des Meßopfers verschaffen. Manche Stelle ging
leicht.
Eingangsgebete, Gloria und Kredo machten keine Schwierigkeit. Aber
harte
Proben an das Gedächtnis stellten die wechselnden Gebete der
stillen
Messe vor und nach der Wandlung. Mancher Satz, von dem man für
sich
glaubte, er müsse wortgetreu im Gedächtnisse haften, war
einfach
nicht zu finden. Auch zu zweit oder dritt kamen wir über
verschiedene
Klippen lange nicht hinweg. Oft eilte ich den langen Gang der Kaserne
auf
und ab und hoffte, durch lautes Aufsagen über den toten Punkt
hinwegzukommen.
Es war ein kalter Dezember im Jahre 1939. Wir Maler arbeiteten in der
fensterlosen
SS-Kaserne und konnten beim besten Willen, selbst wenn er vorhanden
gewesen
wäre, nicht viel Ersprießliches leisten. Um sich zu
erwärmen,
liefen die Häftlinge in der unbewachten Zeit durch die kalten
langen
Gänge und manche Zigarette ging verstohlen in Rauch auf. Bei
diesen
eigenartigen Spaziergängen nahmen wir durch halblautes Rezitieren
immer wieder einen Anlauf, über die Gedächtnislücke
hinwegzukommen.
Schließlich gelang der Freundesdienst. Am Heiligen Abend konnte
ich
meinem Freunde als Weihnachtsgeschenk ein kleines, in den stillen
Abendstunden
geschriebenes Heftchen überreichen, das die gleichbleibenden
Meßgebete
vom Stufengebet bis zum letzten Evangelium enthielt. Der lateinische
Text
wurde noch ins Deutsche übertragen, eine Arbeit, die nicht minder
Kopfzerbrechen machte. Endlich hatten wir unser Lagermissale, das uns
gute
Dienste leistete, wenn auch mancher zünftige Liturg über die
waghalsige Übersetzungskunst den Kopf geschüttelt hätte.
Gerne hätte ich dieses kleine Lagermissale als Andenken
mitgenommen,
aber das war wegen der strengen Kontrolle nicht möglich.
Vielleicht
hat es auch nach meiner Rückkehr in die Freiheit seinen Zweck noch
erreicht. Ich weiß nichts mehr von seinem weiteren Schicksale.
Sicher
aber haben wir den ehrwürdigen Text der Meßgebete, die im
gleichen
Wortlaute ununterbrochen durch den ganzen Erdkreis dringen, mit
größerer
Ergriffenheit gelesen, als aus manchem Prachtband eines Missales mit
Goldschnitt
und erlesener künstlerischer Ausgestaltung. Wir haben ohne Altar
und
ohne prachtvolles Meßgewand in der trostlosen Gleichheit der
Zebra-Uniform
der Häftlinge die ganze Tiefe und Weite der Kirchengebete
gefühlt.
EGO TE ABSOLVO
Was ist eine Seelsorge ohne Sakramente, ohne den Blutstrom des Lebens
vom göttlichen Weinstocke? Wie schwer ist es, in ausgeglichenen
Zeiten
das religiöse Leben aufrechtzuerhalten ohne die Kraftquellen der
regelmäßigen
Gnadenerneuerung durch die unmittelbare Wirkung Christi in der
unausschöpflichen
Gnadenvermittlung der Sakramente? Für die Gefangenen im K. Z.
blieb
jahrelang nur das Sakrament der Buße; und das nur dann, wenn
zufällig
ein Priester als Mithäftling im Lager lebte und die
Möglichkeit
hatte, mit den Kameraden in Verbindung zu kommen.
Daß die Häftlinge, die ihre gemeinsamen Sonntagsfeiern
hielten,
mit einer gewissen Regelmäßigkeit das Sakrament der
Buße
empfingen, wird niemand wundernehmen. Daß aber auch Kameraden den
Weg zum Priester fanden, die draußen in der Freiheit bei einem
Leben,
das nicht unter der Last des K. Z. stand, jahre-, ja jahrzehntelang
kaum
in eine Kirche gekommen sind, viel weniger einen Beichtstuhl von innen
gesehen, das gehört zu den Wundern der Gnade. Das waren die
schönsten
Erlebnisse des Seelsorgers, Werkzeug und Zeuge dieser
außerordentlichen
Gnadenvermittlung zu sein. Ein zufälliges Gespräch,
vielleicht
eine aus Kameradschaft geteilte Zigarette, gibt den Anlaß zu
einer
ersten Fühlungnahme. Der Kamerad weiß, daß er einen
Priester
vor sich hat und spürt das Bedürfnis zu einer Aussprache.
Bald
ist das gegenseitige Vertrauen gewonnen und es öffnen sich die
Tiefen
der Seele. Jahrzehnte ohne Christus, vielleicht Jahrzehnte gegen
Christus
leben wieder auf. Im tiefsten Grund einer vom Schicksal
geläuterten
Seele leuchtet der letzte Rest der anima naturaliter christiana (der
von
Natur aus christlichen Seele). Eine sorgenlose Jugend in einem
christlichen
Elternhause lebt wieder auf. Der Schimmer der Kerzen der ersten
Kommunion
glänzt wie ein frohes Flimmern aus weiten, seligen Fernen. Mitten
unter den Trümmern eines scheinbar zwecklos gewordenen Lebens, das
alles zerstörte, was einst schön und erstrebenswert schien,
weht
der Hauch der Gnade. Im wüsten Dorngestrüpp des K. Z.
schreitet
der gute Hirte und holt ein Schäflein heim zu seiner Herde, das
ohne
diese harte Prüfung kaum heimgefunden hätte. Lebensbeichten
von
Menschen, die seit 20 und mehr Jahren das Glück innerer Ruhe kaum
mehr kannten, von Menschen, in deren Seele kaum mehr eine leise Ahnung
von einem religiösen Bedürfnis gelebt hatte, solche
Lebensbeichten
waren nicht Menschenwerk, waren Stunden reinster, frei geschenkter
Gnade.
Wie befreiend klang das ego te absolvo unter irgendeiner Baumkrone oder
in einem stillen Versteck des Waldes als Unterpfand für ein gutes
Sterben oder als Wendepunkt für ein neues Leben, das Christus im
K.
Z. erweckte.
Aber wie seltsam waren die äußeren Umstände dieser
wohl einzigartigen Beichtpraxis. Nicht das geheimnisvolle Dunkel einer
anheimelnden Kirche mahnte zur Besinnung, kein verschwiegener
Beichtstuhl
lud zum befreienden Bekenntnis. Nirgendwo in den Baracken war ein
kleiner
Raum zu ungestörter längerer Aussprache unter vier Augen. Ein
Gang durch den Wald, der immer wieder durch begegnende Kameraden
gestört
wurde, ein scheinbar zufälliges Spazierengehen auf der
Lagerstraße,
eine unauffällige Rast auf einem Baumstumpf, oftmals unterbrochen
durch Witze oder Klagen vorübergehender Mitgefangener, das war das
äußere Gepräge dieser Lagerbeichten. Nie in meinem
Leben
hätte ich mir vorgestellt, daß ein Beichthören unter
solchen
Umständen möglich wäre. Aber wenn wir auseinandergingen
und die Augen beglückt leuchteten, wenn ein kräftiger
Händedruck
diese Stunde der Gnade abschloß, dann fühlten wir die
Größe
der Kraft und Gnade dieses einzigen Sakramentes, das wir im K. Z.
spenden
konnten.
Wohl hätte einem manchesmal bange werden können vor der
Verantwortung,
die plötzlich dem Priester an Gottes Statt auferlegt wurde.
Fälle,
die normaler Weise reichliches Studium erfordert hätten,
drängten
zur raschen Entscheidung. Kein Bischof konnte befragt oder um
Entscheidung
angegangen werden. Wären selbst Bedenken vorgelegen, wie
hätte
man sie achten können vor einem Menschen, den die barmherzige Hand
des Herrn so offensichtlich berührt hatte. Niemals und nirgends
konnte
man tiefer in menschliche Schicksale schauen als im
Konzentrationslager,
niemals stärker fühlen, daß die verworrensten Knoten
menschlicher
Lebensrätsel nicht anders gelöst werden können als durch
das für Zeit und Ewigkeit befreiende: "Ich spreche Dich los von
Deinen
Sünden". Diese Stunden der Mitwirkung mit der Gnade des
Erlösers
allein schon machten die harten Lagerjahre zu einem Erlebnis, das man
nicht
mehr missen möchte. Sie bewiesen aber auch, wie gut und verstehend
mit den Schwächen der Menschen der sein muß, der als
Bußrichter
verzeihender göttlicher Gerechtigkeit und Liebe aufgestellt ist.
PRIESTERKAMERADEN
Es gab im Lager nicht nur Stunden tiefster Niedergeschlagenheit, im
Gegenteil: es kamen auch solche befreienden Frohsinns. Der Mensch kann
wahrlich bescheiden werden, wenn er sich damit abgefunden hat, alles
hinter
sich zu lassen, was sonst das Leben bequem und froh macht. Die
Erfüllung
eines bescheidenen Wunsches brachte uns schon eine warme Welle der
Freude,
die man in der Sattheit früherer Tage nie empfunden hätte.
Ein
paar Zigaretten nach langem Rauchverbot im Lager, ein unerwarteter
freier
Nachmittag in freundschaftlichem Beisammensein, einige Stunden Sonne
nach
langem, ödem Regen, ein Zusammentreffen mit Landsleuten, ein
Gespräch
über die Heimat stimmt uns so froh und glücklich, wie man es
im K. Z. nicht vermutet hätte. Wie oft sagten wir in diesen
geschenkten
Stunden, wenn einer den andern in Witz und Scherzen zu überbieten
suchte: Jetzt sollten unsere Angehörigen uns sehen, sie
würden
die Ungewißheit um unser Schicksal leichter tragen.
Die Priesterkameraden trafen sich im Lager natürlich öfter.
Anfangs waren wir unser drei. Vor Kriegsbeginn kamen mit der
vorübergehenden
Räumung von Dachau auch Berufskollegen aus der Heimat nach
Buchenwald.
War das ein Begrüßen und Fragen, ein Austauschen von
Erlebnissen
und Erfahrungen. Gleichzeitig mit etwa 1000 tschechischen
Intellektuellen
kamen 20 tschechische Priester, unter ihnen der im ganzen Lager bald
beliebte
P. Anton, ein rundlicher Franziskaner, der monatelang in seinem Habit
herumgehen
mußte und von vielen im Lager anfangs wie ein Weltwunder
angestaunt
wurde. Die Lagerkost ließ sein Bäuchlein bald verschwinden,
aber P. Antons Humor blieb nach wie vor lagerbekannt. Nach wenigen
Tagen
waren die freundschaftlichen Beziehungen zu den neu zugezogenen
Mitbrüdern
hergestellt. So bekamen wir nicht nur ein wirkliches Bild der Lage in
den
Ländern, nach denen der grausame Krieg greifen sollte, wir
sprachen
uns auch gründlich aus, wie sich nach diesen Erfahrungen die
Neugestaltung
des religiösen und sozialen Lebens anfassen ließ. Wir haben
mit offenem Freimut auch manche Fehler und Irrwege besprochen, die wir
selbst in der Seelsorge und in der Politik gegangen.
Der Zufall führte wie so oft im Leben auch hier Menschen aus
entlegensten
Gegenden zusammen, und auch im K. Z. sahen wir, wie klein die Welt ist.
Der alte ehemalige Dekan von Prüm in der Eifel kam in das Lager,
weil
er den Reichsmarschall Göring in einer Waldgaststätte bei
Maria
Laach in der Eifel angeblich absichtlich nicht gegrüßt
hatte.
Er und sein Begleiter mußten in ihren Amtskleidern stundenlang
über
eigens aufgeschüttete spitze Steine schreiten und mit erhobener
Hand
eine SS-Mütze grüßen - ein moderner Geßlerhut zur
Sühne einer Majestätsbeleidigung. Bald nach der ersten
Begrüßung
erinnerten wir uns an das schöne Prüm, wo ich seinerzeit in
besseren
Tagen nach einer wundervollen Autofahrt durch die Eifel einen Vortrag
gehalten
hatte.
Als nach Ausbruch des Krieges die Masseneinlieferung polnischer
Geistlicher
begann, begegnete ich bald einigen Mitbrüdern, die ich bei meinen
Vorträgen vor den deutschen Katholiken in Polen in Kattowitz,
Königshütte
usw. kennengelernt hatte. Da die Zahl der eingelieferten polnischen
Geistlichen
in die Hunderte ging, war es kaum mehr möglich, mit allen
näher
bekannt zu werden. Sie übermittelten uns ein erschütterndes
Bild
des Ausrottungskampfes gegen die Kirche in ihrer Heimat, wo die
Priester
nicht nur verhaftet und in die Lager geschleppt, sondern zu Hunderten
an
Ort und Stelle getötet wurden. Bald begann auch bei uns das
Sterben
und viele wurden in andere Lager, wie in das Todeslager im Steinbruch
von
Mauthausen bei Linz an der Donau, versetzt. - Als eines Tages 50
gefangene
polnische Feldkuraten gegen jedes Völkerrecht von einem
Offiziersgefangenenlager
in das K. Z. gebracht wurden, konnte ich mich trotz des Verbotes in
ihre
Baracke schleichen und ihnen den Gruß der Mitbrüder bringen.
Wir sprachen von ihrer Heimat und von meinem Besuche im herrlichen
Zakopane
in der Hohen Tatra, Ich erzählte ihnen unter
anderem von einem wundersamen Volksliede der Goralen, der Bergbauern
dieser Gegend, deren schmucke Heimattracht weitum bekannt ist. Da sagte
plötzlich ein junger Feldkurat: "Ich will dieses Lied singen, es
ist
das Lied meiner Heimat, mein Vater ist Goral in der Nähe von
Zakopane."
Und in der dumpfigen Baracke des K. Z. erklang die sanfte, zarte Weise:
"Goral, Goral, kennst du deine Berge ..." Alle saßen in tiefem
Schweigen
und dachten an die verlorene Heimat.
Wie bemühten wir uns, das Lagerleben gegenseitig zu erleichtern
und uns gegenseitig mit allem auszuhelfen, vor allem den
Mitbrüdern
in der Strafkompanie, die jede unwürdige Arbeit leisten und dabei
Hunger leiden mußten. Sonntags z. B. standen sie hungrig bei
jedem
Wetter während des Mittagessens am Tore. Diese gegenseitige
Gastfreundschaft
war ja arm und karg, aber manches Stücklein trockenes Brot wurde
oft
dankbarer entgegengenommen als früher ein Festessen an
reichgedeckter
Tafel.
Die Not des Lagerlebens, die sinnlose Zerstörung in aller Welt,
der seelische Aufruhr der Völker bis in die innersten Tiefen des
religiösen
und sozialen Lebens gingen auch an uns Eingesperrten nicht spurlos
vorüber.
Denn wir erlebten ja die schlimmsten Verirrungen einer toll gewordenen
Zeit und unser Verständnis, unsere Einstellung zu vielen Problemen
der Zukunft wurden klarer und hellsichtiger. Viele Fragen von
einschneidender
Bedeutung wurden mit Freimut besprochen, da keinerlei Rücksicht
eine
klare Stellungnahme trübte. Jeder von uns im K. Z. hatte nicht nur
gelernt tiefer in die Zusammenhänge seelischen und menschlichen
Zusammenbruches
zu schauen, sondern auch eine klarer umrissene Einstellung zu manchen
Fragen
bezogen, deren Größe und Bedeutung uns erst dann klar werden
wird, wenn wir das ganze Trümmerfeld unserer Zeit überschauen
können, in dessen Ruinen doch wieder neues, auch religiöses
Leben
erblühen wird. Von den Mitbrüdern aber, die der grausame Tod
im K. Z. hinwegraffte, möge das Wort Wahrheit werden, das einst
der
Ruhm der Urkirche war: Sanguis martyrum, semen christianorum (Das Blut
der Märtyrer ist der Same neuer Christen).
MAIANDACHT
Müde schleppten sich die Arbeitskolonnen in das Lager. Die
Maisonne
brannte schon heiß auf die Arbeitsstätten nieder und
peinigte
die ausgehungerten Körper. Fast verdrossen klang das Lagerlied
durch
die heimwärts ziehenden Reihen:
Halte Schritt, Kamerad, und verlier nicht den Mut,
Wir tragen den Willen zum Leben im Blut
Und im Herzen, im Herzen den Glauben.
War zufällig keine Nachtarbeit angesetzt, die vom Mittagessen
(halb 5 Uhr) bis zur Morgendämmerung dauerte, dann blieb manchmal
ein halbes Stündlein für eine besinnliche Lager-Maiandacht.
Von
einem versteckten Plätzchen des Waldes am Berge schauten ein paar
gute Freunde mit brennenden Augen in die Weite. Ihre Gedanken eilten zu
den Kirchen der Heimat, wo sie ihre Lieben um den Maialtar versammelt
wußten.
Und wenn die Sonne sich zur Scheide anschickte, hielten sie ihre
Lager-Maiandacht.
Keine Glocke lud sie zu weihevoller Andacht, kein Lied zur
Maienkönigin
klang durch einen traulichen Raum. Vielleicht daß ein
Vöglein
ein schüchternes Abendlied in die leere Öde dieses
Maienabends
sang. Und doch klangen in unseren Ohren die Abendglocken der Heimat,
wir
hörten das sanfte Echo ihrer Stimmen aus den Bergen und
Tälern.
Wir hörten, wie helle Kinderstimmen um den blumengeschmückten
Altar den Lobpreis der Himmelskönigin sangen. Wir sahen die
flackernden
Kerzen um das Bild der Mutter aller Gnade. Es war uns, als knieten wir
dort in einem stillen, verborgenen Winkel und beteten mit:
"Trösterin der Betrübten, bitt' für uns, Hilfe der
Christen,
bitt' für uns!"
Mit schlichter Innigkeit beteten die schmalen Lippen das Ave Maria.
Leise sang der milde Abendwind im jungen Grün uralter Bäume.
Schweigend, als fühlten wir die segnende Mutterhand auf den
müden
Scheiteln, beugten wir uns der starken seelischen Wirkung dieser
schlichtesten
Maiandacht, die wir je erlebt. "Jetzt werden daheim die Aveglocken
läuten",
unterbrach ein Kamerad die geheimnisvolle Stille. Ja, Glocken der
Heimat,
dachten wir, klingt auch uns und lehret uns mit starkem Willen, mit
gläubigem
Vertrauen und ungebrochener Ergebung in dieser Stunde beten: Ich bin
die
Magd des Herrn, mir geschehe nach Deinem Worte.
Der Postenwechsel an den Maschinengewehren der hohen
Bewachungstürme
und der schrille Ton der Signalpfeife vom Tore mahnte zum raschen
Abbruch
der in die Heimat träumenden Maiandacht. Doch wir wußten:
auch
unser Tag hatte seinen Sinn. Auf dem Wege zur Baracke sprachen wir noch
davon: Jetzt werden sie daheim von uns reden, wie sie für uns
gebetet
haben. Vielleicht knien ein paar treue Menschen noch einsam in der
Heimatkirche
und empfahlen uns dem besonderen Schütze der Mutter der Gnade.
Ein Kamerad summte für sich das Marienlied: Maria,
Maienkönigin,
Dich will der Mai begrüßen... Keiner von uns wußte in
dieser Stunde, was uns der Mai bringen werde. Doch lebte in uns das
Vertrauen,
daß, was immer in diesen Maiwochen kommen möge, in denen wir
das Fürbittegebet der Maiandacht in der Heimat wie stärkenden
Tau in unserem dürstenden Gemüte fühlten, wir nicht
umsonst
Maiandacht gehalten hatten.
AVE MARIA IM BUNKER
Jedes Konzentrationslager hatte seine Spezialitäten, die im Laufe
der Zeit nach Laune oder besonderen Einfällen der Grausamkeit
wechselten.
Wenn man die Berichte von Kameraden, die mehrere Lager durchgemacht
hatten,
verfolgte, so mußte man zur Überzeugung kommen, daß
die
Lagerführungen sich gegenseitig überboten, um ihr Lager in
einen
möglichst berüchtigten Ruf zu bringen. Es ist hier nicht der
Platz, die unvorstellbaren Grausamkeiten der "Sonderbehandlung" von
Häftlingen
in den Bunkern, den Gefängnissen der Lager, und die grausamen,
teuflischen
Quälereien entmenschter Henker zu schildern.
Wer nach einigen Wochen Bunkerbehandlung wieder in das Lager
zurückkam,
brauchte nicht viel zu erzählen, sein Aussehen verriet, was er
erlebt
hatte. Und dabei gab es Schutzhäftlinge, die Monate, sogar Jahre
dieses
traurige Leben im Bunker fristen mußten. Aber selbst in diesen
Stätten
des Grauens waren durch die Gnade Christi getragene Seelen stärker
als aller Haß und satanische Bosheit der Menschen. Der erste
Sekretär
des Kanzlers Dr. Dollfuß, der nachmalige Präsident der
Finanzlandesdirektion
in Salzburg DDr. Otto Kemptner, erlebte monatelang die Bunkereinsamkeit
in Dachau und die Strafkompanie in Buchenwald. In den sechs gemeinsamen
Haftmonaten in der Polizeikaserne in Salzburg hat mir Freund Kemptner
schon
Andeutungen gemacht, er wolle nach seiner Freilassung Priester werden.
Wohl in den Monaten der Sonderbehandlung des Bunkers ist dieser Ruf der
besonderen Gnade zur Reife gelangt. Wenige Monate nach der Befreiung
trat
er als Kleriker in das Augustinerstift St. Florian ein. Aber er starb
wenige
Monate vor der Feier seines ersten heiligen Meßopfers an den
Folgen
der Entbehrungen des Lagerlebens.
Zu den Opfern des Bunkers gehörte auch der frühere
Sicherheitsdirektor
von Vorarlberg, dann von Salzburg, Gendarmerieoberst Bechinie, der in
Dachau
und in Buchenwald über 20 Monate Lagerbunker durchmachen
mußte.
Die letzten Wochen vor der Überführung in das Lager, wo er
abgemagert
bis zum Skelett ankam - wir hätten die einst so kraftvolle Gestalt
nicht wieder erkannt -, verbrachte er zusammen mit einem Pfarrer der
Salzburger
Erzdiözese, Johann Schroffner aus Oberndorf bei St. Johann in
Tirol.
Diese beiden Männer, so verschieden geartet in Lebensart,
Lebensauffassung,
Abstammung und Charakteranlage, waren im Bunker gute Freunde geworden.
Mit allen Mitteln suchten sie sich über die Trostlosigkeit ihrer
Lage hinwegzuhelfen. Und wenn keine Zerstreuung, keine Erinnerung an
bessere
Zeiten mehr helfen wollte, dann flüchteten ihre Gedanken und ihr
Sinnen
in eine andere Welt. Sie vertieften sich in religiöse
Gespräche
und suchten in gemeinsamem Gebet inneren Halt. Ihre besondere Zuflucht
war die Mutter Gottes, die Trösterin aller Betrübten. Wie oft
mögen sie miteinander den Rosenkranz gebetet haben! Als Oberst
Bechinie
zu uns ins Lager kam, kannte er die lauretanische Litanei auswendig. So
oft hatten sie in ihrem grenzenlosen Elend gemeinsam diese Hilferufe
der
Christenheit zur Mutter Gottes emporgeschickt. Im Lager suchte Bechinie
mit gerade kindlicher Begeisterung Anschluß an unsere
Sonntagsfeiern,
die uns in ihrer naiven Einfalt manche Gefahr hätte
heraufbeschwören
können.
Beide durch dasselbe grausame Los Freunde gewordene Bunkerkameraden,
die ungezählte Ave Maria miteinander gebetet hatten, haben wohl
nicht
geahnt, daß ihr Bittruf, der durch die Bunkergitter drang: "Bitt'
für uns arme Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes!",
das letzte gemeinsame Abendgebet ihres Lebens war. Pfarrer Schroffner,
den Oberst Bechinie verhältnismäßig wohlbehalten
verlassen
hatte, starb wenige Wochen später an uns unbekannter Todesursache.
Ich habe meinen Landsmann und Mitbruder im Lager nie gesehen, habe ihm
nie ein Trostwort sagen und mit ihm keine Erinnerungen an gemeinsame
Studienjahre
mehr austauschen können. Wir konnten nur von ihm reden und seiner
gedenken. Bechinie, schon vom Tode gezeichnet, starb nach der Autofahrt
zusammen mit mehreren Häftlingen. Man hatte an ihnen wohl eine der
neuen Waffen zur Vernichtung wehrloser Menschen erprobt.
Das Ave Maria im Bunker war verstummt. Aber sicher war es denen, die
es beteten, in der Stunde ihres grausamen Todes Trost und Hilfe.
"IST JEMAND KRANK UNTER EUCH,.."
Besonders schmerzlich war es für uns, daß unsere
seelsorgliche
Hilfe auch nicht einmal Kranken und Sterbenden zuteil wurde. Das
Krankenhaus
(Revier) diente ja nicht der Heilung und Betreuung, sondern gerade dort
wütete der Tod. Die ins Auge springende Unzulänglichkeit des
Häftlingskrankenhauses war schon ein äußerer Beweis
dafür,
daß man mit dem Lagergrundsatze, den man uns oft genug
vorbrüllte,
ernst machte: "Im Lager gibt es nur Gesunde oder Tote." Es war daher
nicht
verwunderlich, daß sich im Krankenhause Prügelszenen
abspielten,
daß die Stätte, die der Heilung gewidmet sein sollte, eine
Versuchsstation
für neue Todesarten wurde. Eine längere Beschäftigung im
Revier, die mit größerem Einblick in dessen grauenhafte
Geheimnisse
verbunden war, konnte jedem Häftling lebensgefährlich werden.
Ein Wissender war im Lager immer ein Gefährdeter.
Der natürliche Tod war eine Seltenheit. Wo hätte man dann
Kranke oder Sterbende suchen sollen? Selbst wenn wir das heilige
Öl
für das Sakrament der Krankenölung hätten in das Lager
schmuggeln
können, so hätten wir trotzdem nur in besonderen
Ausnahmefällen
die Möglichkeit gehabt, den Auftrag des Apostels Jakobus zu
erfüllen:
"Ist jemand krank unter euch, so rufe er die Priester der Kirche..."
Nur
ein einzigesmal konnte ich durch einen Zufall einem Sterbenden
beistehen,
als er, in den letzten Zügen liegend, zum Morgenappell getragen
wurde.
Als ein Sterbender einmal im Krankenhause um den Beistand eines
Priesters
bat, bekam er unter zynischen Witzen die Antwort, ein Stück
Weißbrot
könne ihm auch ein SS-Mann reichen, wenn ihm dann leichter sei.
Wie aufgeschlossen für die letzten Tröstungen der Religion
wären ungezählte Sterbende gewesen, mit welcher Innigkeit
hätten
sie die Wegzehrung für die Reise in eine bessere Heimat empfangen.
Sie wäre ihnen das Unterpfand für einen friedlichen und
glücklichen
Ausklang eines, mit irdischem Maß gemessen, sinnlosen Lebens
gewesen.
Und dennoch wird der Hauch der Gnade, die wir so oft im Leben
gespürt
haben, vielen die Not des grauenvollen einsamen Todes verklärt
haben.
Die einzige Krankenseelsorge, die einzige Betreuung der Sterbenden, die
eine Kugel getroffen oder die völlig ermattet zusammenbrachen und
den Geist aufgaben, bestand in der Weckung der dauernden Bereitschaft
und
in ständigem Hinweis auf die vollkommene Reue in der Todesstunde
mit
dem Blick auf den Kreuzeshügel und dem erlösenden Wort des
sterbenden
Gottmenschen an den Mithäftling und Mitgekreuzigten: Heute noch
wirst
du bei mir im Paradiese sein!
BLUTTAUFE
Mit erbarmungsloser Härte wütete die Vernichtung gegen die
jüdischen Häftlinge. Es gelang zwar
verhältnismäßig
zahlreichen vermögenden Juden die Pässe für Ausreise aus
Deutschland zu erlangen. Gar mancher wurde plötzlich in der Nacht
durch den Lautsprecher geweckt, wurde entlassen, mit einem Auto zum
D-Zug
nach Weimar gebracht, der ihn im Fluge zum Luxusdampfer in das Ausland
führte. Diese Juden waren Zeugen des grausamen Geschehens im K. Z.
für die ganze Welt. So wurden die Vorgänge in den deutschen
Lagern
auf der ganzen Erde bekannt. So kam es, daß man in Schanghai, in
amerikanischen Städten, in Palästina, auf dem ganzen Erdkreis
genau über Buchenwald und andere Konzentrationslager Bescheid
wußte,
während das deutsche Volk keine Ahnung davon hatte. Die Juden im
Lager,
die keine Möglichkeit hatten, die Ausreisepapiere zu erlangen,
waren
dem Tode geweiht und der Zionsstern auf ihren Häftlingskleidern
war
ein Mahnmal des Feuerofens.
Die Arbeit führte uns auch mit jüdischen Häftlingen
zusammen. Daß sich ein Österreicher mit einem jüdischen
Landsmann, der noch dazu ein Berufskollege war, schnell zusammenfand,
liegt
auf der Hand. Ein hartes, gemeinsames Schicksal führt die Menschen
eben näher zusammen, als noch so viele gemeinsame Tage auf der
Höhe
eines interessanten Berufslebens.
So lernte ich auf dem Holzhof von Buchenwald den Wiener jüdischen
Journalisten Walter Süß kennen. Er war ein echter Vertreter
der Wiener Linksjournalistik.
Ein geistvoller Erzähler, ohne jede persönliche Beziehung
zu christlicher Weltanschauung. Irgend etwas Geheimnisvolles zog ihn
näher
an mich. Nach manchen Streitgesprächen über religiöse
Probleme
war ich einigermaßen überrascht, als mein Kamerad zur
Weihnachtszeit
1939 sagte, er beginne tiefer und ernster über religiöse
Fragen
und über christliche Weltanschauung nachzudenken. Ich maß
dieser
in meinen Augen wohl mehr schöngeistigen Anwandlung nicht
allzutiefe
Bedeutung bei. Wechsel im Arbeitskommando führte uns auseinander.
Am Karsamstag suchte mich der Kamerad wieder. In langen, sorgenvollen
und
schlaflosen Nächten hatte ihn der einmal gefaßte Gedanke
nicht
mehr losgelassen. Er war so weit in seinem Entschlüsse, nach der
Rückkehr
aus dem Lager Christ zu werden. Als Halbjude sah er noch einen leisen
Hoffnungsschimmer
auf Befreiung vor sich. Wieder verloren wir uns aus den Augen. Auch war
es ja für beide Teile nicht ganz unbedenklich, sich öfter zu
treffen. Doch immer wieder beschäftigte mich diese
aufgewühlte
Seele, die so heftig um die Wahrheit über die Letzten Dinge rang.
Einige Tage vor Christi Himmelfahrt schlich sich Albert Süß
zu mir. Der verhältnismäßig junge Mann war
körperlich
verfallen. In seiner angeborenen lässigen Körperhaltung sah
er
aus wie ein alter Mann. Doch aus seinem Auge leuchtete ein
eigentümlich
entschlossenes Feuer. Kurzweg sagte er mir: "Kamerad, ich bin mir nun
klar,
ich habe mich durchgerungen. Ich weiß, daß ich das Lager
nicht
mehr lebend verlassen werde. Der Traum meiner Taufe und meines
Eintrittes
in die katholische Kirche im Wiener Stephansdom kann nicht in
Erfüllung
gehen. Ich habe an dich eine große Bitte. Könntest du mich
im
Lager taufen? Ich weiß, daß ich es nicht mehr lange
aushalten
kann."
Eine Judentaufe im K. Z.! Was es bedeutet hätte, wenn dieser
Schritt
bekannt würde, war uns klar. Wir beugten uns in Ehrfurcht vor der
Gnade des barmherzigen Gottes und empfahlen uns seinem Schütze.
Einige
Stunden geheimen Konvertitenunterrichtes angesichts der Todesgefahr
gaben
mir die Gewißheit, daß der Täufling innerlich reif sei
für den Empfang des Sakramentes. Da der Nachmittag des
Pfingstsamstages
voraussichtlich einige freie Stunden bringen würde und an diesem
Tage
in den Heimatkirchen das Taufwasser geweiht wurde, sollte an diesem
Tage
die denkwürdige Taufe stattfinden. Ein verstecktes Plätzchen
im Walde war als Taufort bestimmt. Kaplan Andreas Rieser aus Salzburg
hatte
die Stelle eines Taufpaten übernommen. Als ich dem Täufling
diesen
Entschluß mitteilte, nahm er meine beiden Hände fest in die
seinen und mit Tränen in den Augen sagte er: "Jetzt habe ich meine
Ruhe gefunden."
Als ich am Freitag vor Pfingsten in unserer SS-Kaserne bei der Arbeit
war und mich in Gedanken mit einigen Worten beschäftigte, die ich
bei der Taufe sprechen wollte, hörte ich plötzlich vor den
Fenstern
ein Geschrei. Nach wenigen Minuten keuchte Kaplan Rieser über die
Stiege und stammelte atemlos: "Jetzt haben sie den Walter erschlagen."
Vor den Fenstern unserer Arbeitsstätte hatte sich eine kleine
jüdische
Steinträgerkolonne dahingeschleppt, ein Bild namenlosen Elends
wankender
Gestalten. Ein brüllender Scharführer hatte Walter
Süß,
der nicht mehr weiter konnte, mit einem Knüttel erschlagen. Starr
vor Entsetzen sahen wir vor unseren Fenstern die
blutüberströmte
Leiche liegen. Walter Süß war als Getaufter in die Ewigkeit
gegangen. Er hatte die Begierdtaufe empfangen und sein Blut floß
als Zeichen der Bluttaufe über das wundgeschlagene Haupt in die
erloschenen
Augen.
NIKODEMUSSTUNDEN
Im Lagerleben jedes Häftlings gab es Tage, an welchen das
Maß
des Leides und die Last der peinigenden Ungewißheit alle
Widerstandskraft
zu übersteigen drohte. Es kamen Stunden, in denen die Grenzen des
für Gemüt und Körper Ertragbaren erreicht waren. Solchen
Kameraden über die gefährlichen Klippen des drohenden
Zusammenbruches
hinwegzuhelfen, war eine harte und bittere Aufgabe. Aber wenn sie
gelang,
brachte sie uns das Geschenk wahrster Freundschaft. Und es war nicht
Menschengeist
und Menschenkraft, die uns die richtigen Gedanken, die rechten Worte
finden
ließen, wenn die zermürbte Seele völlig
ausgeschöpft
war. Es war ein Ringen um den Lebensmut, das man nicht schildern, das
man
nur erleben kann.
Dieses Ringen um die letzten Körnlein Hoffnung und Vertrauen
führte
uns in stillen Abendstunden auf langen, einsamen Gängen kreuz und
quer durch den Buchenwald. Es war in seiner Offenbarung der letzten
Tiefen
christlicher Wahrheit und christlicher Lebensweisheit wie die Stunden,
die der Herr dem Ratsherrn Nikodemus schenkte, als er in tiefer Nacht
mit
seinem Herrn und Meister von Seele zu Seele sprach. Düstere Wolken
der Verzweiflung zogen da durch die Seele, Zweifel zerfraß das
Vertrauen
und das ganze mühsam gehütete Gebäude des Glaubens und
des
Gottvertrauens drohte zusammenzubrechen. Das Gewissen wurde unruhig und
durchirrte das ganze frühere Leben. Wenn Worte nicht hinreichten,
dann schritten wir schweigend nebeneinander oder unterbrachen das
Gespräch
und beteten ein kurzes Gebet. Und wenn dann die Gnade doch stärker
war als unser Unvermögen und die verhängnisvollen Klippen
durch
unsichtbare Hilfe von oben überwunden wurden, dann gingen wir
auseinander,
klar und stark, wie Nikodemus den Herrn verließ, denn Christus
war
uns begegnet in den Stunden des Ringens. Eines Abends wurde ich zu
einem
guten und treuen Kameraden gebeten. Er glaubte, die Last und die Qual
nicht
mehr länger tragen zu können. Er war ein aufrechter
Charakter,
den sein starker Wille bisher nie verlassen hatte. In der Heimat hatte
er eines der höchsten Ämter im öffentlichen Leben
bekleidet.
Harte und erniedrigende Behandlung hatten ihn bisher trotz seiner 65
Jahre
nicht gebeugt. Nun schwebten Todesschatten über seinem Haupte.
Nach
der ganzen Behandlung der letzten Wochen war er wohl mit Recht der
Überzeugung,
daß man ihn "fertig machen" wolle. Tagelang mußte er im
Steinbruch
die schwersten Steine im Laufschritt den steilen Berg hinaufschleppen.
Mehrmals brach er unter den Schlägen des Vorarbeiters zusammen,
eines
entarteten politischen Häftlings, der seine Kameraden schlug und
gewissenlos
in den Tod trieb. Einige Mithäftlinge haben ihn später eines
Nachts in Ausübung einer Art Lagerjustiz erhängt. Diesem
Unmenschen
war unser Freund überantwortet und er fragte sich wohl mit Recht,
wie lange er diese Tortur noch aushalten könne.
Ganz unmittelbar stellte er, einer der treuesten Teilnehmer an unseren
Sonntagsfeiern, an mich die Frage: "Ist es Selbstmord, wenn ich in die
Postenkette gehe?" Wenn ein Häftling nur ein paar Schritte
über
die Postenkette, die den Steinbruch oder ein anderes
Außenkommando
umstellte, ging oder absichtlich hinausgetrieben wurde, traf ihn die
tödliche
Kugel. "Vor dem Herrgott", meinte er, "ist es doch gleich, ob ich
morgen
einem Herzschlag erliege oder heute von einer Kugel getroffen werde.
Mein
Ende ist doch unabwendbar beschlossen." Es war wahrlich nicht die
Stunde
zu einer spitzfindigen Auseinandersetzung über diesen Grenzfall
menschlicher
Verantwortung und Willensfreiheit. Ich erinnerte ihn an die
schönen
und ergreifenden Stunden, in denen Christus auch im Lager bei uns war,
und bat ihn schlicht und einfach: "Tue es nicht, überlass' dein
hartes
Schicksal dem Willen Gottes und seiner barmherzigen Gnade!" Ernst
reichten
wir uns die Hand und er sagte mir mit festem Händedruck: "Ich tue
es nicht."
Am nächsten Morgen früh sah ich ihn beim Kommando Steinbruch
antreten. Er grüßte mich durch einen freundlichen Blick und
ein kurzes Winken mit der Hand. Kameraden erzählten mir
später,
er sei gefaßt und ohne den Eindruck eines seelischen Druckes zur
harten Tagesarbeit gegangen. Es war ein Tag, an dem die geheim
gefällten
Urteile vollstreckt wurden. Im Laufe des Vormittags hörten wir in
unserem Kasernenbau oberhalb des Steinbruches Schüsse knallen. Mir
zuckte das Herz zusammen: "Mein guter Kamerad wird doch nicht gefallen
sein?" Wenige Minuten später eilte ein Landsmann, mit dem ich die
erschütternde Unterredung des vergangenen Abends besprochen hatte,
zu unserer Arbeitsstätte. Ich sah es seinem starren Blicke an, was
er brachte, und war nicht überrascht, als er sagte: "Er ist tot."
Das Leben des Ministers Dr. Robert Winterstein war durch den
Vernichtungswillen
seiner Verfolger ausgelöscht. Am gleichen Vormittag traf im
Steinbruch
auch den Führer des Tiroler Heimatschutzes Dr. Richard Steidle die
tödliche Kugel. Man hat der Welt wohl auch in diesem Falle
weismachen
wollen, ein zitternder Greis, dessen Knie unter der Last der schweren
Steine
wankten, habe einen Fluchtversuch gemacht und sei auf der Flucht
erschossen
worden. Als wir am Abend dieses Trauertages tiefbewegt beteten: Herr,
gib
ihm die ewige Ruhe!, waren wir überzeugt, daß der gute Hirte
unseren toten Freund heimgeholt habe in eine bessere und gerechtere
Welt.
Unter dem Eindruck dieses gewaltsamen Sterbens standen die letzten
Augenblicke
unseres Beisammenseins unauslöschlich vor mir: es war die
Nikodemusstunde
eines Todgeweihten.
DIE STIMME DES RUFENDEN IN DER WÜSTE!
.Eine heroische Gestalt, zu der das ganze Lager mit ehrfürchtiger
Bewunderung aufschaute, war der evangelische Pfarrer Schneider aus dem
Hunsrück. Am l. Mai 1938 wurde am Turm über dem Eingangstore
des Lagers erstmalig im Beisein der Häftlinge die Hakenkreuzfahne
gehißt. In langen Reihen standen die Gefangenen. Es herrschte
tiefes
Schweigen, bis das Kommando erklang: "Mützen ab!" In den ersten
Reihen
seines Blocks, ganz in der Nähe des Tores, unmittelbar vor dem
Diensthabenden
der Lagerführung, hatte Pfarrer Schneider seinen Platz. Ein Zug
harter
und entschlossener Energie stand auf seinem markanten Gesicht. Er
konnte
es mit seinem Gewissen nicht vereinen, ein Symbol zu grüßen,
das im innersten Wesen und nach, der letzten Ausstrahlung unchristlich
war. So stand Pfarrer Schneider allein in strammer Haltung mit
bedecktem
Haupte vor der gehißten Flagge. Man mag über diese Haltung
denken
wie man will. Kein Häftling hatte schließlich einen freien
Willen,
keiner beugte sich mit innerer Zustimmung vor dem Geßlerhute.
Für
Pfarrer Schneider aber war diese Grußverweigerung bewußter
Ausdruck seines Bekennermutes.
Er wurde in den Bunker geschleppt, das berüchtigte Gefängnis
im Lager, das er nicht mehr verlassen sollte. Dreizehn Monate erlitt er
die Qualen dieser sadistischen Sonderbehandlung. Häftlinge, die
mit
ihm vorübergehend die Zelle teilten, waren erschüttert von
der
Seelengröße dieses tapferen Mannes. Trotz der Hungerkost,
die
kaum hinreichte, das Leben zu fristen, verweigerte er am Freitag, dem
Todestag
des Herrn, jede Nahrungsaufnahme.
Vor dem einstöckigen Bunkergebäude war der große
Appellplatz,
an dem sich die Häftlinge täglich morgens und abends zum
Zählappell,
meist verbunden mit allerlei Schindereien, einzufinden hatten. An den
höchsten
Festtagen ertönte während der Stille des Abzählens
plötzlich
die mächtige Stimme Pfarrer Schneiders durch die dumpfen Gitter
des
ebenerdigen Bunkers. Er hielt wie ein Prophet seine Festtagspredigt,
das
heißt, er versuchte sie zu beginnen. Am Ostersonntag zum Beispiel
hörten wir plötzlich die mächtigen Worte: "So spricht
der
Herr: Ich bin die Auferstehung und das Leben!" Bis ins Innerste
aufgewühlt
durch den Mut und die Kraft dieses gewaltigen Willens, standen die
langen
Reihen der Gefangenen. Es war, als hätte eine mahnende Stimme aus
einer anderen Welt zu ihnen gerufen, als hörten wir die Stimme
Johannes
des Täufers aus den Kerkern des Herodes, die gewaltige
Prophetenstimme
des Rufenden in der Wüste.
Mehr als einige Sätze konnte er nie sprechen. Dann klatschten
schon die Prügel der Bunkerwächter auf ihn nieder oder ein
roher
Faustschlag schmetterte seinen zermarterten Körper in eine Ecke
des
Bunkers. Mit seinem starken Willen und seiner unbeugsamen Härte
wurde
auch brutale Gewalt nicht fertig. Mehr als einmal schleuderte er dem
gefürchteten
Lagerkommandanten den furchtbaren Vorwurf in das Gesicht: "Sie sind ein
Massenmörder! Ich klage Sie an vor dem Richterstuhle des ewigen
Gottes!
Ich klage Sie an des Mordes an diesen Häftlingen!" Und er
zählte
ihm die Namen der Opfer auf, die in den letzten Wochen ihr Leben lassen
mußten.
Da man mit der granitenen Härte seiner Überzeugung nicht
fertig werden konnte, stempelte man ihn zum Narren, den man durch
Schläge
zum Schweigen bringt. Über ein Jahr hatte er die Qualen des
Bunkers
getragen, bis auch seine Kraft der rohen Gewalt erlag. Keine heile
Stelle
war an seinem Körper, als man ihn tot aus dem Bunker trug. Die
Todesnachricht
wurde im ganzen Lager mit tiefer Bewegung aufgenommen.
Als wollte man eine furchtbare Schuld von sich abwälzen,
verständigte
man die Frau des Toten, die mit sieben Kindern auf die Heimkehr des
Gatten
wartete, von seinem Ableben. Man hatte die Leiche in einen Sarg gelegt,
den geschlossenen Sarg mit Blumen geschmückt. Die Frau des Toten
hörte
Worte tiefen Bedauerns über das unerwartete Hinscheiden des
Gatten,
das ihn leider einige Tage vor der geplanten Entlassung dahingerafft
hätte.
Uns war diese bodenlose Heuchelei der Mörder an der Bahre ihres
Opfers keine Überraschung. Ein Hohngelächter ging durch das
Lager,
denn in diesem Beileid an die trostlose Witwe offenbarte sich der
dämonische
Geist von Buchenwald in seiner ganzen Feigheit. Sein heuchlerisches
Beileid
wurde gewaltig übertönt von den Worten der Anklage und des
Bekenntnisses.
Von der Stimme des Rufenden in der Wüste sprach das Lager noch
nach
Jahren in uneingeschränkter Bewunderung.
NACHSPIEL
Im Sommer 1939 erlosch das Kämpferleben Pfarrer Schneiders. Wenige
Wochen vor Kriegsbeginn, als die Atmosphäre in der ganzen Welt zum
Bersten geladen war und sich in einem aufgeregten Rundfunkkampfe
auslebte,
wurde ganz unerwartet mein Name mit Geburtsdaten zu ungewohnter
Vormittagsstunde
aufgerufen. Dieser Aufruf bedeutete erfahrungsgemäß entweder
Entlassung oder sonst etwas Besonderes. Manche Kameraden glaubten mich
beglückwünschen zu müssen. Ich hatte nicht das
Gefühl,
daß mir die Freiheit winkte. Ich wurde zum Lagerkommandanten
Standartenführer
Koch geführt, für einen gewöhnlichen Schutzhäftling
etwas Außergewöhnliches. Solch ein Gang ließ nichts
Gutes
ahnen, denn die Kugel lag meist ziemlich locker im Revolver des
Allgewaltigen
von Buchenwald. Mancher Häftling wurde nach einer solchen
Vorführung
von den Leichenträgern abgeholt. Ich wurde jedoch wider Erwarten
freundlich
empfangen, über meine Stellung als Geistlicher und Journalist
ausgefragt.
Koch brachte eine Rede zur Sprache, die ich 1932 beim Katholikentage in
Essen gehalten hatte. Ich konnte mir den Zweck dieser nicht
unfreundlichen,
etwas weitausholenden Fragen nicht denken. Da zeigte er mir eine Reihe
von Zeitungen aus Polen und Holland, die mit großen
Überschriften
meldeten: Kanonikus Steinwender in Buchenwald bestialisch ermordet.
Ich war über diese Sensationsmeldungen begreiflicherweise
erstaunt,
wurde mir jedoch im Laufe der weiteren Aussprache klar, daß eine
Verwechslung mit Pfarrer Schneider der Anlaß zu diesen Meldungen
war. Sein heldenhaftes Schicksal war durch entlassene Häftlinge in
Deutschland in einem kleineren Kreise bekannt. Aus Buchenwald
ausgewanderte
jüdische Häftlinge hatten es in der ganzen Welt verbreitet.
Von
Buchenwald wußte man in der weiten Welt ja mehr als etwa in den
friedlichen
Dörfern am Fuße unseres Ettersberges. Auch meine
Einlieferung
in das Lager war schon durch den Straßburger Sender gemeldet
worden.
Irgendeine Nachrichtenquelle hatte mich nun mit Pfarrer Schneider
verwechselt.
Sein grausames Schicksal und sein tragisches Ende sollte ich erlitten
haben.
So ging mein Name durch viele Sender der Welt. Zu ihrem nicht geringen
Schrecken drang die Nachricht auch zu meinen Freunden und
Angehörigen
in der Heimat. Sie hörten die genaue Schilderung meines Todes in
Buchenwald
und glaubten mich tot, bis wieder eine Nachricht von mir kam.
Aus der Frage des Lagerkommandanten, ob ich mich einmal geweigert habe,
die Mütze abzunehmen, ob ich im Bunker gesessen habe, entnahm ich,
daß Schneiders heroisches Ende mit meinem Namen verknüpft
wurde.
Noch zwei Jahre später, als ich schon im stillen Petting am
Waginger
See weilte, brachte der Moskauer Rundfunk dieselbe Meldung wieder, wie
mir Freunde aus Wien, Salzburg und Vorarlberg berichteten.
Ich verließ das Zimmer des Lagergewaltigen mit dem Auftrag, eine
Erklärung niederzuschreiben, daß ich gesund sei und nie eine
Lagerstrafe erhalten hätte. Damit wurde eine Berliner Stelle, die
sich um mich gekümmert hatte, beruhigt und die offizielle
Propaganda
konnte in hellen Farben loslegen, wie über die K. Z. gelogen wird.
Der Fall Steinwender war für sie zur Befriedigung erledigt, der
Fall
Schneider aber blieb ungeahndet. Unvergessen bleibt mir die gewaltige
Stimme
des Predigers aus den Tiefen des Bunkers den ich nie von Angesicht zu
Angesicht
gesehen. Sein Name ist mit goldenen Lettern in das Heldenbuch der
Märtyrer
von Buchenwald eingetragen. Ich lege mit diesen Zeilen den
gebührenden
Lorbeerkranz auf sein Märtyrergrab, das einen wahrhaften
Blutzeugen
seines Glaubens birgt.